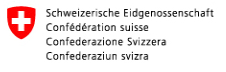Kopien meiner Blogs (Weblog)
als Datensicherung
[ zurück ]
[ Stichworte ]
[ Die Hyper-Bibliothek ]
[ Systemtheorie ]
[ Meine Bücher ]
Inhalt - weiter
Technik - Juli 28, 2014
Vorbemerkung
Mit der Wortendung "-ik" verweise ich im Falle von Technik auf eine relative Indifferenz zwischen Gegenstand und Widerspiegelung, die ich beispielsweise durch die Wortendung "-logie" in Technologie aufhebe, weil ich damit spezifisch die Lehre zur Technik bezeichne.
Effizientes Verfahren
Den Ausdruck Technik verwende ich für die Kunst des Effizient-Seins, also für das, was die alten Griechen als Techne bezeichneten.
• eigentlich verwende ich den Ausdruck als Produkt-Bezeichner für in Artefakten konservierte Verfahren, die mich effizient machen.
• dann verwende ich den Ausdruck Technik in einem übertragenen Sinn als Prozess-Bezeichner für effiziente Tätigkeiten, wenn ich etwa von Verhandlungstechnik oder der Technik eines Künstlers oder eines Fussballers spreche. In diesem übertragenen Sinn beobachte ich ein Verfahren, das in einem Artefakt, etwa in einem Roboter aufgehoben werden kann.
Technik heisst in diesem Sinne die intendiert wiederholbar Verursachungen von institutionalisierten Verfahren, die im entwickelten Fall im externen Gedächtnis, also in Artefakten, die das Verfahren rekonstruierbar machen, gespeichert sind.
Erläuterungen anhand eines Beispiels
Wasser schöpfen kann ich, indem ich mit meinen Händen eine Schale forme. Ich kann jemandem zeigen, wie ich mittels meiner Hände Wasser aus einem Bach trinke. Er kann das Verfahren kopieren und wendet dann eine bestimmte Technik an, die beispielsweise meine Katze nicht anwendet.  Ich kann statt meiner Hände eine Schale verwenden - was mir dann auch zeigt, warum ich davon spreche, dass ich mit meinen Händen eine Schale forme. Ich kann beispielsweise eine hohle Fruchtschale verwenden oder eine hergestellte (artefaktische) Schale.
Jede hergestellte Schale ist bewusst geformtes Material. Ich kann beispielsweise mit meinen Händen eine Schale aus Lehm formen, was etwas ganz anderes ist, als mit den Händen eine Schale zu formen.
Die hergestellte Schale hat eine Gegenstandsbedeutung, die ich erkenne, wenn ich sie als Schale verwende. Die Schale ist in diesem Sinne eine konservierte Anweisung für ein Verfahren, das ich als Schöpfen bezeichne.
Die Schale mittels der Hand zu verwenden, ist in vielen Fällen nicht effizient. Deshalb wird sie oft in Maschinen, beispielsweise in Wasserschöpfeinrichtungen oder in Baggern eingesetzt.
Und natürlich sind auch Maschinen nicht sehr effizient, wenn man sie von Hand steuern muss. Deshalb verwende ich lieber geregelte Maschinen, also Automaten.
Als Technik bezeichne ich mithin einen Handlungszusammenhang, in welchem Verfahren in Artefakten aufgehoben werden.
Im Kontext der ökonomischen Produktion dient die Technik der materiellen Verbesserung des Wohlstandes oder anders ausgedrückt, dem Erübrigen von Arbeit. Ein Roboter kann einen Arbeiter ersetzen, ein PC kann eine Sekretärin zehn Mal schneller machen. "Technik = Arbeit sparen" sagte Ortega y Gasset, (Ropohl, 1979:197)
Im Kontext der Theorie sehe ich den Sinn der Technik in der Entwicklung der Technologie, also in der Entwicklung des Wissens darüber, was wie funktioniert. Die Entwicklung von immer komplizierteren Mechanismen erlaubt die Erklärung von immer komplexeren Phänomenen.
Die Technologie im engeren Sinn beschreibt die Entwicklung der Technik und gibt umgekehrt als Theorie auch eine kategoriale Logik, durch welche ich diese Entwicklung rekonstruiere. Die bislang entwickelste Technik sind Automaten wie Computer, deren Technologie ich als Kybernologie bezeichne, weil ich den spezifischen Aspekt dieser Technik als Kybernetik bezeichne.
Auf der Entwicklungsstufe der Kraftmaschinen erscheint die Technologie noch in den sogenannten Naturwissenschaften, etwa in der Thermodynamik aufgehoben. Erst auf der Stufe der Automaten hat sich die Technologie als Engineering - etwa als Informatik - von den Naturwissenschaften getrennt.
Als Technologie im weiteren Sinn verstehe ich Auffassung (die ich gerne teile), wonach sich der Mensch als toolmaking animal begreifen lässt, wie B. Franklin und nach ihm K. Marx geschrieben haben, um die Wichtigkeit der der Werkzeugentwicklung in ihren Selbstverständnissen hervorzuheben. Das Primitive des Neandertalers waren seine Werkzeuge.
Ich kann beim Gattungswesen Mensch (toolmaking animal) keine wesentliche Entwicklung erkennen, ich erkenne aber leicht, dass die Gattung ihre Technik und mithin ihre Technologie entwickelt. Die "alten" Griechen waren wohl mindestens so intelligent und beweglich wie ich, aber sie hatten keine Computer und deshalb natürlich auch kein Wissen über Computer. Ich - und andere Menschen, die nicht im unberührten Urwald oder in sogenannten Entwicklungsländern leben - scheinen allenfalls entwickelter, weil wir eine entwickeltere Technik (zur Verfügung) haben. Insofern die Werkzeugherstellung ein Gattungskriterium ist, hatten (tauto)logischerweise bereits die ersten Menschen Werkzeuge, wenn auch sehr primitive. Die menschliche Gattung enwickelt nur ihre Technik, Tiere entwickeln sich - von Genmutationen abgesehen - gar nicht.
Aristoteles lebte in einer Epoche der antiken Polis, in welcher die Werkzeuge noch von Sklaven benutzt wurden. Aristoteles entwickelt deshalb sein Geschlecht nicht im Umgang mit Werkzeugen, sondern politisch im Umgang mit Sklaven. Deshalb schien ihm der Menschen ein politisches Tier. B. Franklin, dagegen war als einer der Begründer der USA ein Yankee, der Werkzeuge und Maschinen anstelle der Sklavenhaltung setzen wollte, deshalb sah er das toolmaking animal. Und unabhängig von den beiden, neigt die Geschichtsschreibung dazu, ihre Epochen anhand der Entwicklung der Technologie einzuteilen. In diesem - etwas tierischen - Sinne würde ich allenfalls sagen, der Mensch unserer Epoche ist ein systemerzeugendes Tier.
Ausblick
Ich werde später etwas zur Kybernet-ik schreiben und diese als Teil der Technik von der Kyberno-logie unterscheiden.
Ich kann statt meiner Hände eine Schale verwenden - was mir dann auch zeigt, warum ich davon spreche, dass ich mit meinen Händen eine Schale forme. Ich kann beispielsweise eine hohle Fruchtschale verwenden oder eine hergestellte (artefaktische) Schale.
Jede hergestellte Schale ist bewusst geformtes Material. Ich kann beispielsweise mit meinen Händen eine Schale aus Lehm formen, was etwas ganz anderes ist, als mit den Händen eine Schale zu formen.
Die hergestellte Schale hat eine Gegenstandsbedeutung, die ich erkenne, wenn ich sie als Schale verwende. Die Schale ist in diesem Sinne eine konservierte Anweisung für ein Verfahren, das ich als Schöpfen bezeichne.
Die Schale mittels der Hand zu verwenden, ist in vielen Fällen nicht effizient. Deshalb wird sie oft in Maschinen, beispielsweise in Wasserschöpfeinrichtungen oder in Baggern eingesetzt.
Und natürlich sind auch Maschinen nicht sehr effizient, wenn man sie von Hand steuern muss. Deshalb verwende ich lieber geregelte Maschinen, also Automaten.
Als Technik bezeichne ich mithin einen Handlungszusammenhang, in welchem Verfahren in Artefakten aufgehoben werden.
Im Kontext der ökonomischen Produktion dient die Technik der materiellen Verbesserung des Wohlstandes oder anders ausgedrückt, dem Erübrigen von Arbeit. Ein Roboter kann einen Arbeiter ersetzen, ein PC kann eine Sekretärin zehn Mal schneller machen. "Technik = Arbeit sparen" sagte Ortega y Gasset, (Ropohl, 1979:197)
Im Kontext der Theorie sehe ich den Sinn der Technik in der Entwicklung der Technologie, also in der Entwicklung des Wissens darüber, was wie funktioniert. Die Entwicklung von immer komplizierteren Mechanismen erlaubt die Erklärung von immer komplexeren Phänomenen.
Die Technologie im engeren Sinn beschreibt die Entwicklung der Technik und gibt umgekehrt als Theorie auch eine kategoriale Logik, durch welche ich diese Entwicklung rekonstruiere. Die bislang entwickelste Technik sind Automaten wie Computer, deren Technologie ich als Kybernologie bezeichne, weil ich den spezifischen Aspekt dieser Technik als Kybernetik bezeichne.
Auf der Entwicklungsstufe der Kraftmaschinen erscheint die Technologie noch in den sogenannten Naturwissenschaften, etwa in der Thermodynamik aufgehoben. Erst auf der Stufe der Automaten hat sich die Technologie als Engineering - etwa als Informatik - von den Naturwissenschaften getrennt.
Als Technologie im weiteren Sinn verstehe ich Auffassung (die ich gerne teile), wonach sich der Mensch als toolmaking animal begreifen lässt, wie B. Franklin und nach ihm K. Marx geschrieben haben, um die Wichtigkeit der der Werkzeugentwicklung in ihren Selbstverständnissen hervorzuheben. Das Primitive des Neandertalers waren seine Werkzeuge.
Ich kann beim Gattungswesen Mensch (toolmaking animal) keine wesentliche Entwicklung erkennen, ich erkenne aber leicht, dass die Gattung ihre Technik und mithin ihre Technologie entwickelt. Die "alten" Griechen waren wohl mindestens so intelligent und beweglich wie ich, aber sie hatten keine Computer und deshalb natürlich auch kein Wissen über Computer. Ich - und andere Menschen, die nicht im unberührten Urwald oder in sogenannten Entwicklungsländern leben - scheinen allenfalls entwickelter, weil wir eine entwickeltere Technik (zur Verfügung) haben. Insofern die Werkzeugherstellung ein Gattungskriterium ist, hatten (tauto)logischerweise bereits die ersten Menschen Werkzeuge, wenn auch sehr primitive. Die menschliche Gattung enwickelt nur ihre Technik, Tiere entwickeln sich - von Genmutationen abgesehen - gar nicht.
Aristoteles lebte in einer Epoche der antiken Polis, in welcher die Werkzeuge noch von Sklaven benutzt wurden. Aristoteles entwickelt deshalb sein Geschlecht nicht im Umgang mit Werkzeugen, sondern politisch im Umgang mit Sklaven. Deshalb schien ihm der Menschen ein politisches Tier. B. Franklin, dagegen war als einer der Begründer der USA ein Yankee, der Werkzeuge und Maschinen anstelle der Sklavenhaltung setzen wollte, deshalb sah er das toolmaking animal. Und unabhängig von den beiden, neigt die Geschichtsschreibung dazu, ihre Epochen anhand der Entwicklung der Technologie einzuteilen. In diesem - etwas tierischen - Sinne würde ich allenfalls sagen, der Mensch unserer Epoche ist ein systemerzeugendes Tier.
Ausblick
Ich werde später etwas zur Kybernet-ik schreiben und diese als Teil der Technik von der Kyberno-logie unterscheiden.
[1 Kommentar]
Inhalt
Hypertext und Datenmanagement by CIA - Juli 15, 2014
Die naive Technikkritik , die Kybernetik und den Geheimdienstgründer V. Bush über einen Kamm schert, hat mich bewogen, über V. Bush und seinen Einfluss auf die NSA-Problematik nochmals etwas nachzuschauen.
Vannevar Bush (1890-1974) war in zwei Hinsichten der "Datenmanager" der  USA. Einerseits befasste er als Ingenieur mit der Technik des Datenmanagements (siehe unten), und andrerseits ist er als graue Eminez eine sagenumwobene Figur, weil er von 1939–1955 als Präsident Carnegie Institution for Science in verschiedenen Ausschüssen die kriegsrelevanten Daten der USA managte.
V. Bush verkörpert exemplarisch, fast idealtypisch die us-amerikanische Vermengung von Wirtschaft, Wissenschaft und Politik in der Form der privatrechtlichen "Stiftung", die öffentliche Aufgaben absorbiert.
V. Bush hat diese Art Stiftung nicht erfunden - das war eher A. Carnegie - aber er hat deren Funktion voll entfaltet. Als Stiftungspräsident hatte er ein quasi neutrale Position zwischen den Interessenverbänden, die er mit Stiftungsgeldern versorgte. Er war Berater oder "quasi-interner Interessenkommunikator des US-Präsidenten, und begründete eine eigentlichen Kriegswissenschaft in Form von Kommissionen, wie dem Office of Research, das unter anderem das Manhattenprojekt koordinierte und die Computertechnik vorangetrieben hat, in welcher V. Bush selbst als Ingenieur gearbeitet hatte. Da V. Bush auch die Elektronikfirma Raytheon Company (heute > als 20 Mia $ Umsatz) mitgegründet hatte, war ihm die Finanzierung der Forschung auch von dieser Seite her bestens vertraut.
V. Bush sorgte 1940 noch vor dem Kriegseintritt der USA für die Gründung von allerlei Koordinations- und Kontrollinstanzen, die schliesslich im CIA mündeten (die Chronologie)
27. Juni 1940 NDRC
28. Juni 1941 OSRD
11. Juli 1941 zunächst zivile Office of the Coordinator of Information (COI) ..
8. Dez. 1941 Kriegserklärung
13. Juni 1942 .. in das Office of Strategic Services umgewandelt
1945 Office of Strategic Services (OSS)
20. Sep. 1945 OSS ersetzt durch SSU (Strategic Services Unit)
18. Sep. 1947 National Security Act - CIA
Dez. 1947 OSRD aufgelöst
Die Koordination oder genauer das englische "Controll" von "Forschungsresultaten" aller Art veranlasste V. Bush sich mit grossen Datenmengen und der Automatisierung von deren Verwaltung zu befassen. Er entwickelte den "Rapid Selector" in welchem die Dokumente auf Mikrofilm gespeichert und maschinenlesbar kodiert wurden. Die Maschine wurde 1942 patentiert und unter anderem in Bibliotheken eingesetzt, war aber eine Sackgasse, die V. Bush auf neue Ideen brachte:
Hypertext als Datenmanagement
V. Bush, der bei seiner Koordination der amerikanische Verteidigungsforschung x-tausend Dokumente organisieren musste, erkannte, dass sein Schlagwortverzeichnisse, die ich als a Metatext bezeichne, nicht helfen die Zusammenhänge sichtbar zu machen. Er erkannte, dass Links als innere Textorganisation dazu jeder äusseren Form wie Register überlegen sind. (Was er damals nicht erkennen konnte, war die Automatisierung von Metatext-Verwaltung, die viel später von Google gemacht wurde)
V. Bush stellt diese Erkenntnis in seinem 1945 publizierten Essay As We May Think einerseits pragmatisch in Form der Maschine Memex dar, einer Maschine, die er nur beschrieben, aber nie gebaut hat, weil er nicht mehr als Ingenieur arbeitete. Mit dem Titel seines Textes suggeriert er andrerseits eine Konnotation auf die Kognition, indem er die assoziative Verlinkung - in einem KI-Wahn - mit einem vermeintlich menschlichem Denken verbunden hat. Links - wie V. Bush sie verwendet hat, sind auf dem Papier oder dem Mikrofilm, nicht im menschlichen Denken. Dass wir mit Links gut umgehen können, mag etwas über menschliches Denken sagen, aber keinesfalls etwas darüber, was das Denken ist und wie es funktioniert.
V. Bush hat weder den Link noch das "Verlinken" erfunden, aber er hat das zuvor intuitive Verlinken als bewusste Textorganisation auf den Punkt gebracht. Davor haben ganz viele Texte Verweise auf andere Texte, also auf Fussnoten oder andere Aufsätze und Bücher enthalten. Vor allem in Lexika war es schon lange üblich Schlagworte als Verweise zu lesen. V. Bush hat das in seiner Memex bewusst konstruiert, also als mechanische Verknüpfung angedacht.
Das, was ich als eigentlichen Hypertext kenne, hat noch ein paar Voraussetzungen, die V. Bush noch nicht so vorausgesehen hat. Der wohl wichtigste Aspekt ist das Maus-GUI, das D. Engelbart zwanzig Jahre später (ab 1962) in einer ebenfalls revolutionären Arbeit unter dem Begriff Augmentation of Man's Intellect vorgestellt hat. D. Engelbart machte eine Referenz auf V. Bush, aber sein Titel spricht eine ganz andere, bewusst technische Sprache, in welcher die Technik nicht vermenschlicht wird, sondern als Mittel des Menschen erscheint.
Ich hole hier etwas aus, um den Beitrag von V. Bush deutlicher zu machen. Der technologische Durchbruch in Bezug auf das schliesslich überwachte Internet war - nochmals 10 Jahre später - der Xerox Alto, der 1973 von Xerox PARC vorgestellt wurde, der erste Computer mit einer grafischen Benutzeroberfläche (GUI) und einer Maus, wie er schliesslich 1984 - als nochmals 10 Jahre später - als Macintosh von Apple auf den Markt kam.
T. Nelson hat die Idee des eigentlichen Links in seinem Projekt Xanadu entfaltet und 1974 in "Dream Machines" vorgestellt, wobei er auch den Ausdruck "Hypertext" eingeführt hat. Aber auch das blieb graue Theorie bis Apple die Dreammachine 1987 als Hypercard auf den Markt gebracht und damit ein grundlegendes Konzept des WWWs realisiert hatte. Dann ging die Entwicklung plötzlich sehr rasch. 1989 schlug T. Berners-Lee ein Protokoll für ein weltweites Netzwerk vor, das quasi über Nacht zum WWW wurde.
Bei V. Bush geht es aber gerade darum, wie man Text organisieren kann, wenn man keine Computer und vor allem keine Suchmaschinen und schon gar kein automatisiertes Datamining kennt. Er hatte also noch keine Ahnung davon, was Google ein paar Jahr mit dem WWW machen würde, und wie seine Agenturen a la NSA dann das WWW "kontrollieren" würden - obwohl er wie J. Hoover und J. McCarthy genau das herbeigewünscht und viel - aber nicht viel technologisches - dazu beigetragen hat.
Eine kleine dazu passende Verschwörungstheorie:
V. Bush erkannte sehr früh, wie wichtig die Technologie der Datenverarbeitung werden würde und hat deshalb in seiner Funktion als Verwalter des militärisch-kommerziellen Komplexes die Xerox überreden können, die Entwicklung in den PARC auszulagern und mit staatlichen Geldern zu finanzieren, so dass der Staat umgekehrt auch immer wusste, was da kommen würde. Der Xerox PARC und die Tatsache, dass Xerox von den Erfindungen des PARC so wenig profitiert hat, rufen förmlich nach einer Verschwörung. Am lautesten ist dieser Ruf natürlich durch die Affären geworden, die mit Xerox's Praktiken nach 2000 endgültig Schluss gemacht und den Firmenwert von Xerox auf einen Bruchteil reduziert haben.
USA. Einerseits befasste er als Ingenieur mit der Technik des Datenmanagements (siehe unten), und andrerseits ist er als graue Eminez eine sagenumwobene Figur, weil er von 1939–1955 als Präsident Carnegie Institution for Science in verschiedenen Ausschüssen die kriegsrelevanten Daten der USA managte.
V. Bush verkörpert exemplarisch, fast idealtypisch die us-amerikanische Vermengung von Wirtschaft, Wissenschaft und Politik in der Form der privatrechtlichen "Stiftung", die öffentliche Aufgaben absorbiert.
V. Bush hat diese Art Stiftung nicht erfunden - das war eher A. Carnegie - aber er hat deren Funktion voll entfaltet. Als Stiftungspräsident hatte er ein quasi neutrale Position zwischen den Interessenverbänden, die er mit Stiftungsgeldern versorgte. Er war Berater oder "quasi-interner Interessenkommunikator des US-Präsidenten, und begründete eine eigentlichen Kriegswissenschaft in Form von Kommissionen, wie dem Office of Research, das unter anderem das Manhattenprojekt koordinierte und die Computertechnik vorangetrieben hat, in welcher V. Bush selbst als Ingenieur gearbeitet hatte. Da V. Bush auch die Elektronikfirma Raytheon Company (heute > als 20 Mia $ Umsatz) mitgegründet hatte, war ihm die Finanzierung der Forschung auch von dieser Seite her bestens vertraut.
V. Bush sorgte 1940 noch vor dem Kriegseintritt der USA für die Gründung von allerlei Koordinations- und Kontrollinstanzen, die schliesslich im CIA mündeten (die Chronologie)
27. Juni 1940 NDRC
28. Juni 1941 OSRD
11. Juli 1941 zunächst zivile Office of the Coordinator of Information (COI) ..
8. Dez. 1941 Kriegserklärung
13. Juni 1942 .. in das Office of Strategic Services umgewandelt
1945 Office of Strategic Services (OSS)
20. Sep. 1945 OSS ersetzt durch SSU (Strategic Services Unit)
18. Sep. 1947 National Security Act - CIA
Dez. 1947 OSRD aufgelöst
Die Koordination oder genauer das englische "Controll" von "Forschungsresultaten" aller Art veranlasste V. Bush sich mit grossen Datenmengen und der Automatisierung von deren Verwaltung zu befassen. Er entwickelte den "Rapid Selector" in welchem die Dokumente auf Mikrofilm gespeichert und maschinenlesbar kodiert wurden. Die Maschine wurde 1942 patentiert und unter anderem in Bibliotheken eingesetzt, war aber eine Sackgasse, die V. Bush auf neue Ideen brachte:
Hypertext als Datenmanagement
V. Bush, der bei seiner Koordination der amerikanische Verteidigungsforschung x-tausend Dokumente organisieren musste, erkannte, dass sein Schlagwortverzeichnisse, die ich als a Metatext bezeichne, nicht helfen die Zusammenhänge sichtbar zu machen. Er erkannte, dass Links als innere Textorganisation dazu jeder äusseren Form wie Register überlegen sind. (Was er damals nicht erkennen konnte, war die Automatisierung von Metatext-Verwaltung, die viel später von Google gemacht wurde)
V. Bush stellt diese Erkenntnis in seinem 1945 publizierten Essay As We May Think einerseits pragmatisch in Form der Maschine Memex dar, einer Maschine, die er nur beschrieben, aber nie gebaut hat, weil er nicht mehr als Ingenieur arbeitete. Mit dem Titel seines Textes suggeriert er andrerseits eine Konnotation auf die Kognition, indem er die assoziative Verlinkung - in einem KI-Wahn - mit einem vermeintlich menschlichem Denken verbunden hat. Links - wie V. Bush sie verwendet hat, sind auf dem Papier oder dem Mikrofilm, nicht im menschlichen Denken. Dass wir mit Links gut umgehen können, mag etwas über menschliches Denken sagen, aber keinesfalls etwas darüber, was das Denken ist und wie es funktioniert.
V. Bush hat weder den Link noch das "Verlinken" erfunden, aber er hat das zuvor intuitive Verlinken als bewusste Textorganisation auf den Punkt gebracht. Davor haben ganz viele Texte Verweise auf andere Texte, also auf Fussnoten oder andere Aufsätze und Bücher enthalten. Vor allem in Lexika war es schon lange üblich Schlagworte als Verweise zu lesen. V. Bush hat das in seiner Memex bewusst konstruiert, also als mechanische Verknüpfung angedacht.
Das, was ich als eigentlichen Hypertext kenne, hat noch ein paar Voraussetzungen, die V. Bush noch nicht so vorausgesehen hat. Der wohl wichtigste Aspekt ist das Maus-GUI, das D. Engelbart zwanzig Jahre später (ab 1962) in einer ebenfalls revolutionären Arbeit unter dem Begriff Augmentation of Man's Intellect vorgestellt hat. D. Engelbart machte eine Referenz auf V. Bush, aber sein Titel spricht eine ganz andere, bewusst technische Sprache, in welcher die Technik nicht vermenschlicht wird, sondern als Mittel des Menschen erscheint.
Ich hole hier etwas aus, um den Beitrag von V. Bush deutlicher zu machen. Der technologische Durchbruch in Bezug auf das schliesslich überwachte Internet war - nochmals 10 Jahre später - der Xerox Alto, der 1973 von Xerox PARC vorgestellt wurde, der erste Computer mit einer grafischen Benutzeroberfläche (GUI) und einer Maus, wie er schliesslich 1984 - als nochmals 10 Jahre später - als Macintosh von Apple auf den Markt kam.
T. Nelson hat die Idee des eigentlichen Links in seinem Projekt Xanadu entfaltet und 1974 in "Dream Machines" vorgestellt, wobei er auch den Ausdruck "Hypertext" eingeführt hat. Aber auch das blieb graue Theorie bis Apple die Dreammachine 1987 als Hypercard auf den Markt gebracht und damit ein grundlegendes Konzept des WWWs realisiert hatte. Dann ging die Entwicklung plötzlich sehr rasch. 1989 schlug T. Berners-Lee ein Protokoll für ein weltweites Netzwerk vor, das quasi über Nacht zum WWW wurde.
Bei V. Bush geht es aber gerade darum, wie man Text organisieren kann, wenn man keine Computer und vor allem keine Suchmaschinen und schon gar kein automatisiertes Datamining kennt. Er hatte also noch keine Ahnung davon, was Google ein paar Jahr mit dem WWW machen würde, und wie seine Agenturen a la NSA dann das WWW "kontrollieren" würden - obwohl er wie J. Hoover und J. McCarthy genau das herbeigewünscht und viel - aber nicht viel technologisches - dazu beigetragen hat.
Eine kleine dazu passende Verschwörungstheorie:
V. Bush erkannte sehr früh, wie wichtig die Technologie der Datenverarbeitung werden würde und hat deshalb in seiner Funktion als Verwalter des militärisch-kommerziellen Komplexes die Xerox überreden können, die Entwicklung in den PARC auszulagern und mit staatlichen Geldern zu finanzieren, so dass der Staat umgekehrt auch immer wusste, was da kommen würde. Der Xerox PARC und die Tatsache, dass Xerox von den Erfindungen des PARC so wenig profitiert hat, rufen förmlich nach einer Verschwörung. Am lautesten ist dieser Ruf natürlich durch die Affären geworden, die mit Xerox's Praktiken nach 2000 endgültig Schluss gemacht und den Firmenwert von Xerox auf einen Bruchteil reduziert haben.
[2 Kommentar]
Inhalt
Naive Technikkritik und Technologische Kritik - Juli 6, 2014
S. Lobo ist ein exemplarischer Repräsentant des Diskurses, in welchem das Internet nicht technisch sondern medial gesehen wird. Technik und Technologie wird dabei tabuisiert, womit ein funktionaler Diskurs - beispielsweise über Überwachung oder über arabische Frühlinge und dergleichen als Internetgeschichten- generiert wird. In einem aktuellen Vortrag über seine NSA-Überwachung-Phobien gibt S. Lobo eingangs einen kleinen Abriss zum Internet, in welchem er die Technik für die Überwachung, gegen die sich die "Zivilgesellschaft" wehren müsse, wenigstens mitverantwortlich macht. Er macht damit ganz gewöhnliche Technikkritik, wonach die Technik zunächst Mittel ist, aber bald ganz schlimme Folgen zeigt.
S. Lobos Geschichte beginnt damit, dass die Deutschen 1938 Hitler zujubeln, weil sie die Welt "am deutschen Wesen genesen lassen wollen".  Weil die Deutschen also den Krieg wollen, wollen die Engländer eine Flugzeugabwehrkanone, weshalb die Amerikaner eine Kriegstechnik erfinden, in welcher S. Lobo den Urgrund der schliesslich totalen Überwachung sieht. Den Ausgangspunkt der schliesslich in Bezug auf Überwachung so fatalen Kriegstechnik sieht S. Lobo einerseits in der Kybernetik von N. Wiener, die für die Flugzeugabwehr entwickelt worden sei, und andrerseits in der Erfindung der Hypertextmaschine Memex durch V. Bush, mittels welcher das Wissen aller Forscher so effizient organisiert werden konnte, dass die Entwicklung der Atombombe möglich geworden sei. Nachdem dann die Erfindung der Maus den PC und das Internet herbeiführte, war der "Urgrund auf der Hinführung zur Überwachung" gelegt.
Ich will hier nicht auf die Dialektik von Überwachen und Technik eingehen, nur wenigstens anmerken, dass schon in den Schlauheiten von Sun Tsu steht, dass man seine Gegner kennen muss, und dass die Briefpost und das Telefon überwacht wurden, lange bevor das Internet existierte. Der FBI-Gründer J. Hoover öffnete jeden (ihm) beliebigen Brief und installierte an jedem (ihm) beliebigen Ort Mikrophone. Mir geht es nicht um Überwachung und den Krieg, den S. Lobo sinnigerweise den "Deutschen" zuschreibt. Mir geht es um die ausgeblendete Technologie. Der Vortrag von S. Lobo macht - unabhängig von seinem Gegenstand - ein paar Aussagen zur Kybernetik, die zeigen, dass S. Lobo das Wesen der Kybernetik nicht im Geringsten verstanden hat. Das ist für sich genommen natürlich ohne jede Relevanz. Seine Ängste können trotzdem begründet sein. Mir geht es nicht um S. Lobo, sondern darum, wie Technik in populistischen Darstellungen verzehrt und als Sack geschlagen wird, weil der Esel nicht zuhanden ist.
S. Lobo schildert die Kybernetik als Kontroll- und Steuerungswissenschaft, die vorausberechne. In kolportierten Beispiel würde mittels der Kybernetik berechnet, wo das Flugzeug sich befinde, wenn die Kanonen"patrone" auch dort sei. Immerhin sieht er, dass die Katze ohne Computer und Kybernetik voraus berechnet, wo die Maus sein wird, nachdem die Katze ihren Fangsprung gemacht hat.
Technologische Kritik
"Controll and communication" steht im Kontext der Kybernetik von N. Wiener für Regelung, nicht für Kontrolle im Sinn des deutschen Wortes. Regelung bedeutet gerade nicht Steuerung aufgrund von Wissen über das Ziel, wie es S. Lobo ausführlich darstellt, sondern ein Reagieren auf Abweichungen von einem Sollwert. Sein Beispiel mit der Flugabwehrkanone ist gerade kein Beispiel für Regelung und mithin kein Beispiel für Kybernetik. Es geht in der Kybernetik gerade nicht darum, etwas voraus zu berechnen, sondern im genauen Gegenteil darum, im Nachhinein zu reagieren, also um Feedback.
V. Bush hat in gewisser Weise den Hypertext und damit ein grundlegendes Konzept des WWWs - nicht des Internets - erfunden. Bei V. Bush geht es aber gerade darum, wie man Text organisieren kann, wenn man keine Computer und keine Suchmaschinen hat und schon gar kein automatisiertes Datamining kennt. Seinen Titel "As we may think" erläutert er mit dem Unterschied zwischen assoziativem Denken und Karteiablagesystemen.
D. Engelbart hat die Maus erfunden. Die Maus und das zugehörige GUI sind neben Computer und Telefonnetz von der aktuellen Technik so wenig wegdenkbar wie Bleistift und Papier, aber sie sind in keiner Weise wichtig oder gar Grundlagen des überwachten Internets. Um mails und Webseiten zu schreiben, braucht niemand eine Maus.
Und um Vorträge übers Internet zu halten, muss man über Technik und Kybernetik gar nichts wissen, aber es wär nicht schlecht, wenn Leute, die zur Technik nichts sagen können, darüber schweigen würden.
Weil die Deutschen also den Krieg wollen, wollen die Engländer eine Flugzeugabwehrkanone, weshalb die Amerikaner eine Kriegstechnik erfinden, in welcher S. Lobo den Urgrund der schliesslich totalen Überwachung sieht. Den Ausgangspunkt der schliesslich in Bezug auf Überwachung so fatalen Kriegstechnik sieht S. Lobo einerseits in der Kybernetik von N. Wiener, die für die Flugzeugabwehr entwickelt worden sei, und andrerseits in der Erfindung der Hypertextmaschine Memex durch V. Bush, mittels welcher das Wissen aller Forscher so effizient organisiert werden konnte, dass die Entwicklung der Atombombe möglich geworden sei. Nachdem dann die Erfindung der Maus den PC und das Internet herbeiführte, war der "Urgrund auf der Hinführung zur Überwachung" gelegt.
Ich will hier nicht auf die Dialektik von Überwachen und Technik eingehen, nur wenigstens anmerken, dass schon in den Schlauheiten von Sun Tsu steht, dass man seine Gegner kennen muss, und dass die Briefpost und das Telefon überwacht wurden, lange bevor das Internet existierte. Der FBI-Gründer J. Hoover öffnete jeden (ihm) beliebigen Brief und installierte an jedem (ihm) beliebigen Ort Mikrophone. Mir geht es nicht um Überwachung und den Krieg, den S. Lobo sinnigerweise den "Deutschen" zuschreibt. Mir geht es um die ausgeblendete Technologie. Der Vortrag von S. Lobo macht - unabhängig von seinem Gegenstand - ein paar Aussagen zur Kybernetik, die zeigen, dass S. Lobo das Wesen der Kybernetik nicht im Geringsten verstanden hat. Das ist für sich genommen natürlich ohne jede Relevanz. Seine Ängste können trotzdem begründet sein. Mir geht es nicht um S. Lobo, sondern darum, wie Technik in populistischen Darstellungen verzehrt und als Sack geschlagen wird, weil der Esel nicht zuhanden ist.
S. Lobo schildert die Kybernetik als Kontroll- und Steuerungswissenschaft, die vorausberechne. In kolportierten Beispiel würde mittels der Kybernetik berechnet, wo das Flugzeug sich befinde, wenn die Kanonen"patrone" auch dort sei. Immerhin sieht er, dass die Katze ohne Computer und Kybernetik voraus berechnet, wo die Maus sein wird, nachdem die Katze ihren Fangsprung gemacht hat.
Technologische Kritik
"Controll and communication" steht im Kontext der Kybernetik von N. Wiener für Regelung, nicht für Kontrolle im Sinn des deutschen Wortes. Regelung bedeutet gerade nicht Steuerung aufgrund von Wissen über das Ziel, wie es S. Lobo ausführlich darstellt, sondern ein Reagieren auf Abweichungen von einem Sollwert. Sein Beispiel mit der Flugabwehrkanone ist gerade kein Beispiel für Regelung und mithin kein Beispiel für Kybernetik. Es geht in der Kybernetik gerade nicht darum, etwas voraus zu berechnen, sondern im genauen Gegenteil darum, im Nachhinein zu reagieren, also um Feedback.
V. Bush hat in gewisser Weise den Hypertext und damit ein grundlegendes Konzept des WWWs - nicht des Internets - erfunden. Bei V. Bush geht es aber gerade darum, wie man Text organisieren kann, wenn man keine Computer und keine Suchmaschinen hat und schon gar kein automatisiertes Datamining kennt. Seinen Titel "As we may think" erläutert er mit dem Unterschied zwischen assoziativem Denken und Karteiablagesystemen.
D. Engelbart hat die Maus erfunden. Die Maus und das zugehörige GUI sind neben Computer und Telefonnetz von der aktuellen Technik so wenig wegdenkbar wie Bleistift und Papier, aber sie sind in keiner Weise wichtig oder gar Grundlagen des überwachten Internets. Um mails und Webseiten zu schreiben, braucht niemand eine Maus.
Und um Vorträge übers Internet zu halten, muss man über Technik und Kybernetik gar nichts wissen, aber es wär nicht schlecht, wenn Leute, die zur Technik nichts sagen können, darüber schweigen würden.
[15 Kommentar]
Inhalt
die Schweiz als Staat - Juni 11, 2014
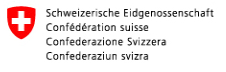 Weil ich gerade über Staat und Verfassung nachdenke, habe ich exemplarisch in die Selbstdarstellung des Staates "Schweiz" im Internet geschaut . Was die Schweiz jenseits des Staates ist, sagten früher schon Kulturschaffende: "La Suisse n' existe pas".
Die Selbstdarstellung der "Schweizerischen Eidgenossenschaft" - so heisst der Staat offiziell - im Internet hat die sinnige URL www.admin.ch und nicht, wie ich naiverweise erwartet habe die URL www.schweiz.ch
Der Name der URL zeigt mir, dass es nicht um die Schweiz ("die Schweiz existiert nicht") geht, sondern um die Administration des Staates "Schweiz", der so "existiert", dass sich seine Administration von dieser selbst so beschreiben lässt, wie sie es tut.
Die Selbstdarstellung der Schweizerischen Administration unterscheidet folgende Hauptbereiche:
•Aktuell
•Die Bundesbehörden
•Bundesrecht
•Dokumentation
•Dienstleistungen
und quasi reflexiv schreibt die Administration "Über dieses Portal": Willkommen bei den Schweizerischen Bundesbehörden!
Das "Portal" und dessen Gliederung erscheinen als Ausdruck eines Dilemmas im Selbstverständnis der "administrative Verwaltung". Sie weiss nicht, ob sie den Staat (und dessen Bevölkerung - als Volk) führt oder administriert. Und sie "informiert" zu sehr vielen Zusammenhängen, die sinnvollerweise bereits unter www.schweiz.ch zu finden sind.
In meinem (wohl naiven) Verständnis wären die Behörden eine Folge des Rechtes, sie erscheinen aber in der Darstellung des Staates an erster Stelle, wie wenn sie das Recht verfügen würden, was wohl auch einem Selbstverständnis des Führens entspricht.
Als Bundesrecht, das erst an zweiter Stelle steht, erscheint nicht etwa die Staats-Verfassung, sondern eine "Systematische Rechtssammlung", in welcher "Landesrecht" und "Internationales Recht" unterschieden wird. Die Selbst-Unterstellung unter internationales Recht erscheint so nicht als Teil der Staats-Verfassung, sondern als etwas von aussen Aufgezwungenes.
Die "Systematische Rechtssammlung" beginnt dann weder mit dem Landesrecht noch mit dem internationalen Recht, sondern - einer eigenartigen Pragmatik folgend - mit Neuigkeiten und Stichwörtern.
Das Landesrecht schliesslich ist auch nicht die Verfassung, sondern in folgende Kapitel unterteilt:
1 Staat – Volk – Behörden
2 Privatrecht – Zivilrechtspflege – Vollstreckung
3 Strafrecht – Strafrechtspflege – Strafvollzug
4 Schule – Wissenschaft – Kultur
5 Landesverteidigung
6 Finanzen
7 Öffentliche Werke – Energie – Verkehr
8 Gesundheit – Arbeit – Soziale Sicherheit
9 Wirtschaft – Technische Zusammenarbeit
Die Bundes-Verfassung, die unter administrativen Gesichtspunkten über allem steht, erscheint als erster Eintrag im sinnig bezeichneten Kapitel "Staat – Volk – Behörden", in welchem Staat und Volk im Unterschied zu den Behörden keine eigenen Abschnitte bilden. Dass das Volk Souverän des Staates wäre, scheint eine selbstverständliche Fiktion.
Der Staat ingesamt erscheint in dieser Darstellung als von Behörden administrierte Institution, die neben öffentlichen Werken, die zunehmend privatisiert werden, und einer Armee auch noch eine Verfassung hat.
Weil ich gerade über Staat und Verfassung nachdenke, habe ich exemplarisch in die Selbstdarstellung des Staates "Schweiz" im Internet geschaut . Was die Schweiz jenseits des Staates ist, sagten früher schon Kulturschaffende: "La Suisse n' existe pas".
Die Selbstdarstellung der "Schweizerischen Eidgenossenschaft" - so heisst der Staat offiziell - im Internet hat die sinnige URL www.admin.ch und nicht, wie ich naiverweise erwartet habe die URL www.schweiz.ch
Der Name der URL zeigt mir, dass es nicht um die Schweiz ("die Schweiz existiert nicht") geht, sondern um die Administration des Staates "Schweiz", der so "existiert", dass sich seine Administration von dieser selbst so beschreiben lässt, wie sie es tut.
Die Selbstdarstellung der Schweizerischen Administration unterscheidet folgende Hauptbereiche:
•Aktuell
•Die Bundesbehörden
•Bundesrecht
•Dokumentation
•Dienstleistungen
und quasi reflexiv schreibt die Administration "Über dieses Portal": Willkommen bei den Schweizerischen Bundesbehörden!
Das "Portal" und dessen Gliederung erscheinen als Ausdruck eines Dilemmas im Selbstverständnis der "administrative Verwaltung". Sie weiss nicht, ob sie den Staat (und dessen Bevölkerung - als Volk) führt oder administriert. Und sie "informiert" zu sehr vielen Zusammenhängen, die sinnvollerweise bereits unter www.schweiz.ch zu finden sind.
In meinem (wohl naiven) Verständnis wären die Behörden eine Folge des Rechtes, sie erscheinen aber in der Darstellung des Staates an erster Stelle, wie wenn sie das Recht verfügen würden, was wohl auch einem Selbstverständnis des Führens entspricht.
Als Bundesrecht, das erst an zweiter Stelle steht, erscheint nicht etwa die Staats-Verfassung, sondern eine "Systematische Rechtssammlung", in welcher "Landesrecht" und "Internationales Recht" unterschieden wird. Die Selbst-Unterstellung unter internationales Recht erscheint so nicht als Teil der Staats-Verfassung, sondern als etwas von aussen Aufgezwungenes.
Die "Systematische Rechtssammlung" beginnt dann weder mit dem Landesrecht noch mit dem internationalen Recht, sondern - einer eigenartigen Pragmatik folgend - mit Neuigkeiten und Stichwörtern.
Das Landesrecht schliesslich ist auch nicht die Verfassung, sondern in folgende Kapitel unterteilt:
1 Staat – Volk – Behörden
2 Privatrecht – Zivilrechtspflege – Vollstreckung
3 Strafrecht – Strafrechtspflege – Strafvollzug
4 Schule – Wissenschaft – Kultur
5 Landesverteidigung
6 Finanzen
7 Öffentliche Werke – Energie – Verkehr
8 Gesundheit – Arbeit – Soziale Sicherheit
9 Wirtschaft – Technische Zusammenarbeit
Die Bundes-Verfassung, die unter administrativen Gesichtspunkten über allem steht, erscheint als erster Eintrag im sinnig bezeichneten Kapitel "Staat – Volk – Behörden", in welchem Staat und Volk im Unterschied zu den Behörden keine eigenen Abschnitte bilden. Dass das Volk Souverän des Staates wäre, scheint eine selbstverständliche Fiktion.
Der Staat ingesamt erscheint in dieser Darstellung als von Behörden administrierte Institution, die neben öffentlichen Werken, die zunehmend privatisiert werden, und einer Armee auch noch eine Verfassung hat.
[0 Kommentar]
Inhalt
Tai Chi - Mai 20, 2014
Eine Reflexion zum praktizierten Dialog.
Als Taiji bezeichne ich eine ursprünglich in asiatischen Kulturen praktizierte Lehre, die die Differenz zwischen dem Äussersten und dem Zentrum reflektiert und dafür das Yin-Yang-Symbol - das eben Taiji heisst - verwendet. TaiJi erscheint moralisch aufgeladen als Daoismus und als Konfuzianismus.
Taiji ist die äusserste Abstraktion oder die erste Wahrnehmung/Beobachtung (die "Form" im Sinne von G. Spencer Brown). Tai Chi "beobachtet" den Weg im Sinne der Bewegung des Chi's, die den Weg ausmacht.
TaiJi ist eine Praktik zu der die Lehre komplementär ist. Ich kann TaiJi nicht anders verstehen als im bewussten und reflektierten Praktizieren.
Jede Praxis ist TaiJi, wenn sie es ist.
Auf dem Weg zum Tai Ji gibt es Uebungen. Ich unterscheide diesbezüglich zwischen TaiJi und TaiJi-Veranstaltungen. Die TaiJi-Veranstaltung ist als Übung konzipiert. Ich übe aber in der TaiJi-Veranstaltung nicht für einen späteren Zeitpunkt, für einen Auftritt oder für einen Ernstfall, ich übe im Sinne des Ausübens. Die Übung zeigt sich vor allem darin, dass wir uns ein Protokoll geben, also festlegen, was wie geübt wird, während TaiJi natürlich gerade keine Regeln haben kann, die jemand einhalten müsste.
Ein bekanntes Praktizieren heisst Taijiquan und besteht aus Übungen, sogenannten Katas oder Kreisen, die als Master Art (Kampfkunst) entwickelt wurden.
Eine andere Art des Übens ist Qi Gong, das sich stärker oder unmittelbarer mit der Gesundheit befasst.
Taijiquan und Qi Ging wird in Form von langsamen Bewegungen praktiziert, die Bewegungsfolgen gehören zur Lehre und werden in Kursen vermittelt.
In der Kampfkunst gibt es drei Stufen des Lernens. Shu ist wie „gehorche“ – alles wird genau nach Rezept oder „Prozess“ ausgeführt und bis zu absoluter Fehlerfreiheit eingeübt. Ha steht für „probiere“ – man weicht von der Lehre ab, sammelt Erfahrungen durch Variation und versteht langsam die Kunst an sich. Ri bedeutet „verlasse“ – der Meister löst sich von den Formen, den Lehren und Stilen seiner Vorbilder und vollendet sich.
Die Lehre:
besteht in einer Leere von Störungen der Harmonie oder des Gleichgewichtes, was sich auch als Hemmung des Flusses von Chi in den Meridianen zeigt. In diese Absenz von Störungen kann man nur Meditation gelangen, die vollständige Absenz ist die Leer oder die Erleuchtung.
Alle Störungen sind Störungen der Balance zwischen yin und jang, es sind Fixierungen der Sinne.
Taiji bezeichne ich eine ursprünglich in asiatischen Kulturen praktizierte Lehre, die die Differenz zwischen dem Äussersten und dem Zentrum reflektiert und dafür das Yin-Yang-Symbol - das eben Taiji heisst - verwendet. TaiJi erscheint moralisch aufgeladen als Daoismus und als Konfuzianismus.
Taiji ist die äusserste Abstraktion oder die erste Wahrnehmung/Beobachtung (die "Form" im Sinne von G. Spencer Brown). Tai Chi "beobachtet" den Weg im Sinne der Bewegung des Chi's, die den Weg ausmacht.
TaiJi ist eine Praktik zu der die Lehre komplementär ist. Ich kann TaiJi nicht anders verstehen als im bewussten und reflektierten Praktizieren.
Jede Praxis ist TaiJi, wenn sie es ist.
Auf dem Weg zum Tai Ji gibt es Uebungen. Ich unterscheide diesbezüglich zwischen TaiJi und TaiJi-Veranstaltungen. Die TaiJi-Veranstaltung ist als Übung konzipiert. Ich übe aber in der TaiJi-Veranstaltung nicht für einen späteren Zeitpunkt, für einen Auftritt oder für einen Ernstfall, ich übe im Sinne des Ausübens. Die Übung zeigt sich vor allem darin, dass wir uns ein Protokoll geben, also festlegen, was wie geübt wird, während TaiJi natürlich gerade keine Regeln haben kann, die jemand einhalten müsste.
Ein bekanntes Praktizieren heisst Taijiquan und besteht aus Übungen, sogenannten Katas oder Kreisen, die als Master Art (Kampfkunst) entwickelt wurden.
Eine andere Art des Übens ist Qi Gong, das sich stärker oder unmittelbarer mit der Gesundheit befasst.
Taijiquan und Qi Ging wird in Form von langsamen Bewegungen praktiziert, die Bewegungsfolgen gehören zur Lehre und werden in Kursen vermittelt.
In der Kampfkunst gibt es drei Stufen des Lernens. Shu ist wie „gehorche“ – alles wird genau nach Rezept oder „Prozess“ ausgeführt und bis zu absoluter Fehlerfreiheit eingeübt. Ha steht für „probiere“ – man weicht von der Lehre ab, sammelt Erfahrungen durch Variation und versteht langsam die Kunst an sich. Ri bedeutet „verlasse“ – der Meister löst sich von den Formen, den Lehren und Stilen seiner Vorbilder und vollendet sich.
Die Lehre:
besteht in einer Leere von Störungen der Harmonie oder des Gleichgewichtes, was sich auch als Hemmung des Flusses von Chi in den Meridianen zeigt. In diese Absenz von Störungen kann man nur Meditation gelangen, die vollständige Absenz ist die Leer oder die Erleuchtung.
Alle Störungen sind Störungen der Balance zwischen yin und jang, es sind Fixierungen der Sinne.
[0 Kommentar]
Inhalt
„Crowdfunding“ (Finanzfonds für crowds) - Mai 14, 2014
Two's company, three's a crowd.
Seit kurzer Zeit weht ein neuaufgelegtes Lüftchen durch alle Ritzen: es heisst Crowdfunding und geht so: Etwas, was auf konventionellem Weg keinen Markt finden kann, nimmt den Weg des Spendenaufrufes via social media im Internet. Ich bezeichne diesen Weg als Weg des Bettelns, wobei ich gar nichts gegen das Betteln habe und hier auch etwas anderes thematisieren will: Die Crowd und den Fond.
drängen, also für ausschliessen und zusammenpferchen. Geschäft, in welchem mit dem zusammengesammelten Geld der Crowd Spekulation im grössten Ausmass betrieben wird. Viele kleine Beträge verteilen das Risiko optimal und lassen mehr Risiko und Gewinnaussichten im Verdrängungskampf zu. Die Fonds investieren, wo ein Einzelner um sein Geld Angst hätte. Finanzbasen sind das Resultat von Fonds.
Wenn jemand im Internet - etwa auf Facebook - für einen "guten Zweck" bettelt, kommt oft rasch viel Geld zusammen. Das ist auch bei Massenmedien oft der Fall, etwa wenn im TV für eine "Katastrophe" gesammelt wird. Und wo so viel Geld fliesst, stellt sich rasch ein Vermittler ein, der für seine Dienstleistung einen kleinen Betrag behält, aber umgekehrt viel mehr Aufmerksamkeit erreicht, weil er viele private Bettler vermittelt. Das Muster dazu liefern sogenannte Plattformen wie Facebook, Amazone, ebay usw. Ein Beispiel ist etwa startnext.de, wo für jedes erdenkliche Projekt Geld gesammelt werden kann.
Mehr inhaltlich gesehen ist das crowdfunding natürlich keine neue Erfindung. In Form von Subskription und anderen Verfahren ist es schon sehr lange bekannt. Eine spezielle Variante ist auch der sogenannte Mikrokredit.
Und nachdem nun das Crowdfunding populär geworden ist, gibt es auch die Inversion dazu, die darin besteht, dass eine Privatperson ihr eigenes Projekt nicht mehr via eine fremde Plattform bewirbt, sondern selbst eine Plattform zum Geldsammeln eröffnet.
Ein Beispiel dafür Übersetzung des Lautes "crowd", die auf (Un)Kraut im Sinne des Pöbels verweist. Aus der bitteren Erkenntnis, dass Zeitung mit Inhalt sich nicht mehr kostendeckend verkaufen lassen, erbetteln die Journalisten eine Krautzeitung, in der guten Hoffnung, die Leser würden den Preis der Zeitung bezahlen, wenn sie es in Form von barmherzigen Almosen tun könnten.
Davon abgesehen, dass das sehr unwahrscheinlich ist, entspricht es dem crowdfunding out, indem es andere Zeitungen umso rascher verdrängen wird, was aber auch kein Unglück, oder ohnehin nicht abzuwenden ist.
Einen kurzen èberblick zur Geschichte gibt's hier: http://www.fundable.com/crowdfunding101/history-of-crowdfunding
[2 Kommentar]
Inhalt
systematisch versus systemisch - Mai 11, 2014
 Systematisch beziehe ich im Unterschied zu "systemisch" nicht auf ein System, sondern auf eine (An)Ordnung, was im Mittelalter und dann noch lange in der Philosophie und im Commonsense als "System(a)" bezeichnet wurde und wird. Hier mache ich nur die eine Seite der Differenz explizit.
Als Systematik bezeichne ich die einer Klassifikation zugrunde liegende Anschauung. In den biologischen Systematiken bei Aristoteles und C. von Linné ist das eine Art Entwicklung, in welcher immer kompliziertere Einheiten zusammengesetzt (systema) werden, die später typischerweise als evolutionär gedachte Differenzierung gesehen wurde.
Die Systematik besteht in einer Taxonomie und einer Nomenklatur. In der Taxonomie werden die Objektklassen begründet, in der Nomenklatur wird die Logik der Bezeichnungen festgelegt. Exemplarisch ist das biologische Bestimmungsverfahren, mit welchem Pflanzen aufgrund von Blütenständen und dergleichen bestimmt und entsprechend einer Nomenklatur benannt werden. Ich erläutere das am Beispiel: Eine noch nicht weit entwickelte Systematik kann beispielsweise weltanschaulich auf der Differenz Evolution/Kreation liegen, während die Lebewesen nach Lebensräumen wie Erde/Wasser/Luft klassifiziert werden und die Namen wie Tiger oder Kuh als arbiträre Eigennamen begriffen werden, die dann - wie bei Linné - in einer Nomenklatur mit "Panthera tigris" oder "Bos primigenius taurus" ( mit "Panthera" und "Bos" für Gattungen) aufgehoben werden.
Von einer (voll entwickelten) Systematik spreche ich, wenn die drei Aspekte hinreichen aufeinander bezogen sind. Eine entwickelte Systematik beruht auf einer Theorie. Der exemplarische Fall ist die biologische Evolutionstheorie. Lange bevor die Theorie formuliert war - die C. Darwin von A. Wallace plagiiert hatte - haben sich Klassifikationen verbreitet, die die Evolutionstheorie tendentiell vorweggenommen haben. Aristoteles hat noch gar keine Hypothesen jenseits seines Schauens - es gibt wohl auch niemanden, der ihn je Schauen gesehen hätte.
C. von Linné, der 1758 mit seiner Systema Naturae den Ausdruck System in diesem Sinne populär gemacht hat, hatte eine weitreichende Intuition, obwohl er sich noch keine Evolution vorstellte. Er realisierte auch, dass seine Systematik bei den Pflanzen "irgendwie" besser war als bei den Tieren. Er verwendete eine binäre Nomenklatur zur Benennung der Arten, deren Hauptzweck eine eindeutige Beobachtung (Unterscheidung/Bezeichnung) ist.
C. von Linné verwendete in seiner Systematik den Blüten"aufbau", um die Pflanzen zu klassifizieren. Er teilte die Pflanzen in 24 Klassen ein, seine Begründung der Systematik wurde nach dem Erscheinen von C. Darwin's Origin of Species 1859) ersetzt, weil die Lebewesen dann nach ihrer phylogenetischen Stellung, also nach einem "natürlichen System"geordnet wurden. Die Klassifizierung der tieferen taxonomischen Ränge (Art, Gattung) blieben aber weitgehen erhalten, weil das instinktiv gewählte Kriterium des Blütenbaus stark mit dem Prozess der Artbildung bei Blütenpflanzen zusammenhängt.
Im Tierreich war C. von Linné's „idealistische Morphologie“ vor allem bei höher entwickelten Tieren zu willkürlich und zu weit weg von einer phylogentisch begründeten Einteilung. Zur Rolle der Systematik schrieb C. Darwin in seinem "Entstehung der Arten": „Wenn wir von dieser Idee ausgehen, dass das natürliche System, soweit es durchgeführt werden kann, genealogisch angeordnet ist, so verstehen wir die Regeln, die wir bei der Klassifikation befolgen müssen.“
Es gibt "natürlich" kein natürliches System. Dass die Natur diese Klassifikation nicht selbst besorgt, zeigt sich beispielsweise in E. Mayr's Einordnung der Organismen. Zwar wird die Verzweigungsreihenfolge des phylogenetischen Systems anerkannt (Krokodile und Vögel (Aves) haben einen jüngeren gemeinsamen Vorfahren als die Vögel mit den übrigen Reptilien), der Erwerb des Vogelfluges wird aber - von den menschlichen Beobachtern - als bedeutende Neuerung angesehen, weshalb der Klasse Reptilia die Ordnung Crocodilia zugeordnet und der Klasse der Vögel (Aves) gegenübergestellt wird, wodurch sich paraphyletische Taxa ergeben.
Ich kenne viele Klassifikationen, die intuitiv, das heisst noch ohne Theorie sind. In den meisten Fällen wird eine - meistens nicht reflektierte - Evolutions-Metapher verwendet. Ein typisches Beispiel ist die Klassifikation der Sprachen in Sprachfamilien (was auch noch die "Familie" als Metapher einführt). Wo das Denken unbewusst metaphorisch wird, verschwimmen dann auch die Unterscheidungen, die am ursprünglichen Ort - quasi am Sendegebiet der Metapher - noch gemacht werden. Deshalb erscheint dann die Sprache beispielsweise als System, weil in den Sprachefamilien von Systematik gesprochen wird.
Auf die systemische Seite der Unterschehidung werde ich später einmal genauer eingehen.
Systematisch beziehe ich im Unterschied zu "systemisch" nicht auf ein System, sondern auf eine (An)Ordnung, was im Mittelalter und dann noch lange in der Philosophie und im Commonsense als "System(a)" bezeichnet wurde und wird. Hier mache ich nur die eine Seite der Differenz explizit.
Als Systematik bezeichne ich die einer Klassifikation zugrunde liegende Anschauung. In den biologischen Systematiken bei Aristoteles und C. von Linné ist das eine Art Entwicklung, in welcher immer kompliziertere Einheiten zusammengesetzt (systema) werden, die später typischerweise als evolutionär gedachte Differenzierung gesehen wurde.
Die Systematik besteht in einer Taxonomie und einer Nomenklatur. In der Taxonomie werden die Objektklassen begründet, in der Nomenklatur wird die Logik der Bezeichnungen festgelegt. Exemplarisch ist das biologische Bestimmungsverfahren, mit welchem Pflanzen aufgrund von Blütenständen und dergleichen bestimmt und entsprechend einer Nomenklatur benannt werden. Ich erläutere das am Beispiel: Eine noch nicht weit entwickelte Systematik kann beispielsweise weltanschaulich auf der Differenz Evolution/Kreation liegen, während die Lebewesen nach Lebensräumen wie Erde/Wasser/Luft klassifiziert werden und die Namen wie Tiger oder Kuh als arbiträre Eigennamen begriffen werden, die dann - wie bei Linné - in einer Nomenklatur mit "Panthera tigris" oder "Bos primigenius taurus" ( mit "Panthera" und "Bos" für Gattungen) aufgehoben werden.
Von einer (voll entwickelten) Systematik spreche ich, wenn die drei Aspekte hinreichen aufeinander bezogen sind. Eine entwickelte Systematik beruht auf einer Theorie. Der exemplarische Fall ist die biologische Evolutionstheorie. Lange bevor die Theorie formuliert war - die C. Darwin von A. Wallace plagiiert hatte - haben sich Klassifikationen verbreitet, die die Evolutionstheorie tendentiell vorweggenommen haben. Aristoteles hat noch gar keine Hypothesen jenseits seines Schauens - es gibt wohl auch niemanden, der ihn je Schauen gesehen hätte.
C. von Linné, der 1758 mit seiner Systema Naturae den Ausdruck System in diesem Sinne populär gemacht hat, hatte eine weitreichende Intuition, obwohl er sich noch keine Evolution vorstellte. Er realisierte auch, dass seine Systematik bei den Pflanzen "irgendwie" besser war als bei den Tieren. Er verwendete eine binäre Nomenklatur zur Benennung der Arten, deren Hauptzweck eine eindeutige Beobachtung (Unterscheidung/Bezeichnung) ist.
C. von Linné verwendete in seiner Systematik den Blüten"aufbau", um die Pflanzen zu klassifizieren. Er teilte die Pflanzen in 24 Klassen ein, seine Begründung der Systematik wurde nach dem Erscheinen von C. Darwin's Origin of Species 1859) ersetzt, weil die Lebewesen dann nach ihrer phylogenetischen Stellung, also nach einem "natürlichen System"geordnet wurden. Die Klassifizierung der tieferen taxonomischen Ränge (Art, Gattung) blieben aber weitgehen erhalten, weil das instinktiv gewählte Kriterium des Blütenbaus stark mit dem Prozess der Artbildung bei Blütenpflanzen zusammenhängt.
Im Tierreich war C. von Linné's „idealistische Morphologie“ vor allem bei höher entwickelten Tieren zu willkürlich und zu weit weg von einer phylogentisch begründeten Einteilung. Zur Rolle der Systematik schrieb C. Darwin in seinem "Entstehung der Arten": „Wenn wir von dieser Idee ausgehen, dass das natürliche System, soweit es durchgeführt werden kann, genealogisch angeordnet ist, so verstehen wir die Regeln, die wir bei der Klassifikation befolgen müssen.“
Es gibt "natürlich" kein natürliches System. Dass die Natur diese Klassifikation nicht selbst besorgt, zeigt sich beispielsweise in E. Mayr's Einordnung der Organismen. Zwar wird die Verzweigungsreihenfolge des phylogenetischen Systems anerkannt (Krokodile und Vögel (Aves) haben einen jüngeren gemeinsamen Vorfahren als die Vögel mit den übrigen Reptilien), der Erwerb des Vogelfluges wird aber - von den menschlichen Beobachtern - als bedeutende Neuerung angesehen, weshalb der Klasse Reptilia die Ordnung Crocodilia zugeordnet und der Klasse der Vögel (Aves) gegenübergestellt wird, wodurch sich paraphyletische Taxa ergeben.
Ich kenne viele Klassifikationen, die intuitiv, das heisst noch ohne Theorie sind. In den meisten Fällen wird eine - meistens nicht reflektierte - Evolutions-Metapher verwendet. Ein typisches Beispiel ist die Klassifikation der Sprachen in Sprachfamilien (was auch noch die "Familie" als Metapher einführt). Wo das Denken unbewusst metaphorisch wird, verschwimmen dann auch die Unterscheidungen, die am ursprünglichen Ort - quasi am Sendegebiet der Metapher - noch gemacht werden. Deshalb erscheint dann die Sprache beispielsweise als System, weil in den Sprachefamilien von Systematik gesprochen wird.
Auf die systemische Seite der Unterschehidung werde ich später einmal genauer eingehen.
[6 Kommentar]
Inhalt
Zum Unterschied zwischen (Astro)-nomie und (Öko)-logie - Mai 7, 2014
Ich gehe grundsätzlich und immer davon aus, dass Wörter arbiträr sind. Manche Wörter oder Wortteile (vor allem bei Kunstwörtern aus anderen Sprachen) deute ich aber quasi-etymologisch, womit ich - in einer Art re-entry zum Arbiträren - Zusammenhänge konstruiere. Die Wortendung "-logie" lese ich - w o das Sinn macht - als "Lehre", weil ich viele Lehren so bezeichnet sehe. Es gibt aber auch Wörter, die auf -logie enden, die ich nicht so unmittelbar auf Lehren beziehe, worauf ich zurückkomme. Die Wortendung "-nomie" interpretiere ich - differenziell - als Lehre mit anweisendem Charakter.
Die "Logie" unterstellt deskriptiv vorgefundene (Natur)-Gesetze, die "Nomie" unterstellt präskiptiv vereinbarte (Verfassungs)-Gesetze. Naturgesetze wie etwa jene zur Schwerkraft scheinen unabhängig von Vereinbarungen, ökonomische Gesetze etwa zum Warenwert scheinen irgendwie ausgehandelt. Die "Nomie" reflektiert Gesetze als gemacht. "Nomie" referenziert das griechische Nomos, das für Gesetz im Sinne der Verfassung und für Gebot steht.
Der Haushalt (oikos) wird in der Öko-logie und Öko-nomie beschrieben. In beide Lehren werden Gesetze thematisiert. Naturgesetze kann ich nicht verletzen oder umgehen, während gesellschaftliche Gesetze ihre Verletzung voraussetzen oder wenigstens implizieren. In diesem Sinne stehen "Nomie" und "Logie" für zwei verschiedene Weltanschauungen. Die sich Logie lehrt, wie man sich angesichts der Natur zu verhalten hat, die Nomie lehrt, wie man in der Gesellschaft zu verhalten hat.
Als Exhaustionen bezeichne ich in Anlehnung an T. Kuhn Erklärungen zu nicht zur These passenden Daten. Das Wortpaar Astro-Logie und Astro-Nomie passt nicht zu obigen Überlegungen.
Beim Wortpaar Astro-Logie und Astro-Nomie verwende ich im Ausdruck Astrologie "Logie" im eigentlichen Sinn für eine Lehre, während ich im Ausdruck Astronomie "Nomie" als "historisch falsch gewählten" Ausdruck für eine Teillehre der Astrologie verwende.
Als Astrologie bezeichne ich eine der ersten Wissenschaften - wenn nicht die erste Wissenschaft überhaupt - die sich mit Hypothesen zu empirischen Korrelationen mit Gestirnkonstellationen befasst. Die Binnendifferenzierung führte relativ spät zu einer physikalischen Teillehre, in welcher Konstellationen nur noch diszipliniert naturwissenschaftlich beobachtet werden, was dann - "falscherweise" - als Astronomie bezeichnet wurde, weil Astrologie ja schon besetzt war.
Einen speziellen Fall der Exhaustion ist eine Inversion der Bedeutungen. Die Wahl des Ausdruckes "Astronomie" kann ich auch als bewusste Wahl deuten, wenn ich eine andere Differenz Logie/Nomie beobachte.
Das, was ich - im aktuellen Commonsense - als (Natur)Wissenschaft bezeichne, ist eine Erfindung der Renaissance, die durch G. Galilei's Naturgesetze in Form von Hypothesen initiiert und von I. Newton in der Gravitationstheorie voll entfaltet wurde. In dieser Wissenschaft sind die (Natur)Gesetze fundamental, weshalb eine eigentliche Wissenschaft als "-nomie" bezeichnet wurde, weil Nomos das lateinische Wort für Gesetz ist (was immer die Lateiner mit dem Ausdruck auch meinten).
J. Keppler bezeichnete sein Werk als "Astronomia Nova" und führte so den Begriff ein. Gleichzeitig entstanden die Universitäten, die sich bis heute als Institutionen mit doppeltem Auftrag zu Lehre und Forschung begreifen. Der Ausdruck "Lehre" wird darin neu besetzt, indem er nun die Mitteilung der Lehre bedeutet, also das, was Lehrer tun, auch wenn sie zur Lehre nichts beigetragen haben. Suggeriert wird, dass Lehrer die Lehre lehren.
In dieser Differenz verkehren sich die Verhältnisse. Nomie steht für die Lehre im Sinne der ursprünglichen Logie, während Lehre - immer noch als Logie aufgefasst - das Dogma der Lehrer bezeichnet, das T. Kuhn dann als jeweils in Kraft gesetztes Paradigma bezeichnet hat.
Die Akzeptanz des Homonyms ist die vollständigste Exhaustion oder eben die Aufhebung der Notwendigkeit einer Exhaustion. Wortverwendungen, die nicht zu meiner These passen, kann ich - arbiträrerweise - als Homonyme auffassen, also als Wörter, die ganz zufällig gleich lauten, ohne irgendeine inhaltliche Beziehung zu haben.
In den Ausdrücken "Analogie" oder "Tautologie" beispielsweise beziehe ich "-logie" nicht auf eine Lehre, sondern auf eine wie auch immer gemeinte "logische" Beziehung, die ihrerseits natürlich auch durch eine Lehre begründet sein kann.
Schliesslich gibt es auch Wortverwendungen, in welchen Logie und Nomie gar keinen Bezug zum geteilten Präfix haben. Die Ausdrücke "Gastro-logie" und "Gastro.nomie" beziehen sich auf verschiedene Verwendungen von "Gastro", wobei diese beiden Wörter unabhängig von einander zum obigen Deutungsschema passen, weil Gastrologie für eine - physio"logische" - Wissenschaft steht, während Gastronomie vorschreibt, wie Gäste zu behandeln sind.
o das Sinn macht - als "Lehre", weil ich viele Lehren so bezeichnet sehe. Es gibt aber auch Wörter, die auf -logie enden, die ich nicht so unmittelbar auf Lehren beziehe, worauf ich zurückkomme. Die Wortendung "-nomie" interpretiere ich - differenziell - als Lehre mit anweisendem Charakter.
Die "Logie" unterstellt deskriptiv vorgefundene (Natur)-Gesetze, die "Nomie" unterstellt präskiptiv vereinbarte (Verfassungs)-Gesetze. Naturgesetze wie etwa jene zur Schwerkraft scheinen unabhängig von Vereinbarungen, ökonomische Gesetze etwa zum Warenwert scheinen irgendwie ausgehandelt. Die "Nomie" reflektiert Gesetze als gemacht. "Nomie" referenziert das griechische Nomos, das für Gesetz im Sinne der Verfassung und für Gebot steht.
Der Haushalt (oikos) wird in der Öko-logie und Öko-nomie beschrieben. In beide Lehren werden Gesetze thematisiert. Naturgesetze kann ich nicht verletzen oder umgehen, während gesellschaftliche Gesetze ihre Verletzung voraussetzen oder wenigstens implizieren. In diesem Sinne stehen "Nomie" und "Logie" für zwei verschiedene Weltanschauungen. Die sich Logie lehrt, wie man sich angesichts der Natur zu verhalten hat, die Nomie lehrt, wie man in der Gesellschaft zu verhalten hat.
Als Exhaustionen bezeichne ich in Anlehnung an T. Kuhn Erklärungen zu nicht zur These passenden Daten. Das Wortpaar Astro-Logie und Astro-Nomie passt nicht zu obigen Überlegungen.
Beim Wortpaar Astro-Logie und Astro-Nomie verwende ich im Ausdruck Astrologie "Logie" im eigentlichen Sinn für eine Lehre, während ich im Ausdruck Astronomie "Nomie" als "historisch falsch gewählten" Ausdruck für eine Teillehre der Astrologie verwende.
Als Astrologie bezeichne ich eine der ersten Wissenschaften - wenn nicht die erste Wissenschaft überhaupt - die sich mit Hypothesen zu empirischen Korrelationen mit Gestirnkonstellationen befasst. Die Binnendifferenzierung führte relativ spät zu einer physikalischen Teillehre, in welcher Konstellationen nur noch diszipliniert naturwissenschaftlich beobachtet werden, was dann - "falscherweise" - als Astronomie bezeichnet wurde, weil Astrologie ja schon besetzt war.
Einen speziellen Fall der Exhaustion ist eine Inversion der Bedeutungen. Die Wahl des Ausdruckes "Astronomie" kann ich auch als bewusste Wahl deuten, wenn ich eine andere Differenz Logie/Nomie beobachte.
Das, was ich - im aktuellen Commonsense - als (Natur)Wissenschaft bezeichne, ist eine Erfindung der Renaissance, die durch G. Galilei's Naturgesetze in Form von Hypothesen initiiert und von I. Newton in der Gravitationstheorie voll entfaltet wurde. In dieser Wissenschaft sind die (Natur)Gesetze fundamental, weshalb eine eigentliche Wissenschaft als "-nomie" bezeichnet wurde, weil Nomos das lateinische Wort für Gesetz ist (was immer die Lateiner mit dem Ausdruck auch meinten).
J. Keppler bezeichnete sein Werk als "Astronomia Nova" und führte so den Begriff ein. Gleichzeitig entstanden die Universitäten, die sich bis heute als Institutionen mit doppeltem Auftrag zu Lehre und Forschung begreifen. Der Ausdruck "Lehre" wird darin neu besetzt, indem er nun die Mitteilung der Lehre bedeutet, also das, was Lehrer tun, auch wenn sie zur Lehre nichts beigetragen haben. Suggeriert wird, dass Lehrer die Lehre lehren.
In dieser Differenz verkehren sich die Verhältnisse. Nomie steht für die Lehre im Sinne der ursprünglichen Logie, während Lehre - immer noch als Logie aufgefasst - das Dogma der Lehrer bezeichnet, das T. Kuhn dann als jeweils in Kraft gesetztes Paradigma bezeichnet hat.
Die Akzeptanz des Homonyms ist die vollständigste Exhaustion oder eben die Aufhebung der Notwendigkeit einer Exhaustion. Wortverwendungen, die nicht zu meiner These passen, kann ich - arbiträrerweise - als Homonyme auffassen, also als Wörter, die ganz zufällig gleich lauten, ohne irgendeine inhaltliche Beziehung zu haben.
In den Ausdrücken "Analogie" oder "Tautologie" beispielsweise beziehe ich "-logie" nicht auf eine Lehre, sondern auf eine wie auch immer gemeinte "logische" Beziehung, die ihrerseits natürlich auch durch eine Lehre begründet sein kann.
Schliesslich gibt es auch Wortverwendungen, in welchen Logie und Nomie gar keinen Bezug zum geteilten Präfix haben. Die Ausdrücke "Gastro-logie" und "Gastro.nomie" beziehen sich auf verschiedene Verwendungen von "Gastro", wobei diese beiden Wörter unabhängig von einander zum obigen Deutungsschema passen, weil Gastrologie für eine - physio"logische" - Wissenschaft steht, während Gastronomie vorschreibt, wie Gäste zu behandeln sind.
[16 Kommentar]
Inhalt
Die Genesis der Hyperkommunikation - April 9, 2014
 Ganz Babylon hatte nur eine Sprache und gebrauchte die gleichen Worte. Da sagten sie: wir wollen mit diesen Worten einen Turm bauen, dessen Spitze bis zum Himmel der Erkenntnis reicht. Und sie begannen, Worte zusammenzutragen. Und Jahwe sah zu und sprach: Siehe, das ist erst der Anfang ihres Tuns. Fortan würde für sie nichts mehr unausführbar sein, was immer sie zu tun ersinnen. Deshalb wollen wir ihre Sprache verwirren, so dass keiner mehr die Sprache des andern versteht.
Und Jahwe verwirrte die Sprache radikal - nämlich so, dass keiner mehr dem andern mitteilen kann, dass er ihn nicht versteht, weil der je andere das nicht verstehen würde. Ich kann andere nicht verstehen, aber ich kommuniziere, wenn ich anderen Menschen begegne, wenn ich wahrnehme oder wahrmache, dass sie mich wahrnehmen, und wir dadurch genötigt sind, unser Handeln in gemeinschaftlicher Rücksicht - oder in bewusster gesellschaftlicher Rücksichtslosigkeit - auf den je andern zu wählen. Kommunikation bedeutet nicht, dass wir uns verstehen, sondern dass wir in gemeinsame Prozesse verwickelt sind, die jede Kommune ausmachen.
Wenn ich bewusst kommuniziere, mache ich keine Mitteilungen, weil ich - wenn ich Jahwe nicht frevle - weiss, dass der andere mich nicht versteht. Mitteilungen wären Bausteine zum Turm von Babylon. Kommunikation passiert auf Medien, das letzte Jahrtausend passierte auf Papier. Die Bibel, die durch Gutenbergs Konstruktion geschaffen wurde, ist das Mitteilungsmedium schlechthin. Jahwes Rache an den babylonischen Türmebauern ist plagenhaft subtil. Er gab ihnen das Buch, um sie im Wahn des Mitteilens zu belassen. Jahwe weiss, die technische Erfindung setzt äussere Hilfsmittel an die Stelle echter Kenntnisse, sie verdrängt die überkommenen Formen der Verbreitung und Bewahrung von Wissen und wird daher letztlich nur das Gegenteil von dem erreichen, was ihre Befürworter versprechen.
Natürlich ist Papier und Buchdruck so belanglos wie das Internet und Hypertext. Es handelt sich einfach um technische Erfindungen, die wir medial interpretieren können, weil wir darin Aspekte des Dialoges gefroren wiederfinden. Als artefaktische Medien erklären sie aber, was wir kommunikativ tun. Denn die Sprache und ihre Verwirrungen sind nicht hergestellt, die Artefakte, die Bücher und Hypertexte dagegen schon. Wenn ich Medien nicht utilitaristisch für den Turmbau nutze, sondern reflexiv, werde ich mir meiner Sprache neu bewusst:
Hypertexte machen dann als Mitteilungen demonstrativ keinen Sinn. Als Hyperautor produziere ich zwar Texte, nämlich Textbausteine, ich mache aber mit den Texten keine Mitteilungen, sondern eine Art Vokabular für surfende Hyperleser, die sich ihren Text durch Anklicken von Links erzeugen. Der Hyperleser produziert zwar den gelesenen Text, aber er macht natürlich auch keine Mitteilungen, denn er liest ja immer seinen eigenen, selbst zusammengestellten Hypertext-Text. Die Arbeit am Text erscheint unter dieser Perspektive als Arbeit an einer "Graphit"-Struktur unter ästhetischen Gesichtspunkten, so wie ein bildender Künstler, etwa ein Bildhauer, mit der Entwicklung seines Gegenstandes verfährt. Texte - und mithin Dialoge - sind Kunstwerke, wenn sie keine Mitteilungs-Funktion haben. Hyperkommunikation ist ein Medium des Ausdrucks, sie dient nicht der frevelnden Erkenntnis, sondern der Selbsterkenntnis, der Erfahrung des dialogischen Eingebundenseins.
Ganz Babylon hatte nur eine Sprache und gebrauchte die gleichen Worte. Da sagten sie: wir wollen mit diesen Worten einen Turm bauen, dessen Spitze bis zum Himmel der Erkenntnis reicht. Und sie begannen, Worte zusammenzutragen. Und Jahwe sah zu und sprach: Siehe, das ist erst der Anfang ihres Tuns. Fortan würde für sie nichts mehr unausführbar sein, was immer sie zu tun ersinnen. Deshalb wollen wir ihre Sprache verwirren, so dass keiner mehr die Sprache des andern versteht.
Und Jahwe verwirrte die Sprache radikal - nämlich so, dass keiner mehr dem andern mitteilen kann, dass er ihn nicht versteht, weil der je andere das nicht verstehen würde. Ich kann andere nicht verstehen, aber ich kommuniziere, wenn ich anderen Menschen begegne, wenn ich wahrnehme oder wahrmache, dass sie mich wahrnehmen, und wir dadurch genötigt sind, unser Handeln in gemeinschaftlicher Rücksicht - oder in bewusster gesellschaftlicher Rücksichtslosigkeit - auf den je andern zu wählen. Kommunikation bedeutet nicht, dass wir uns verstehen, sondern dass wir in gemeinsame Prozesse verwickelt sind, die jede Kommune ausmachen.
Wenn ich bewusst kommuniziere, mache ich keine Mitteilungen, weil ich - wenn ich Jahwe nicht frevle - weiss, dass der andere mich nicht versteht. Mitteilungen wären Bausteine zum Turm von Babylon. Kommunikation passiert auf Medien, das letzte Jahrtausend passierte auf Papier. Die Bibel, die durch Gutenbergs Konstruktion geschaffen wurde, ist das Mitteilungsmedium schlechthin. Jahwes Rache an den babylonischen Türmebauern ist plagenhaft subtil. Er gab ihnen das Buch, um sie im Wahn des Mitteilens zu belassen. Jahwe weiss, die technische Erfindung setzt äussere Hilfsmittel an die Stelle echter Kenntnisse, sie verdrängt die überkommenen Formen der Verbreitung und Bewahrung von Wissen und wird daher letztlich nur das Gegenteil von dem erreichen, was ihre Befürworter versprechen.
Natürlich ist Papier und Buchdruck so belanglos wie das Internet und Hypertext. Es handelt sich einfach um technische Erfindungen, die wir medial interpretieren können, weil wir darin Aspekte des Dialoges gefroren wiederfinden. Als artefaktische Medien erklären sie aber, was wir kommunikativ tun. Denn die Sprache und ihre Verwirrungen sind nicht hergestellt, die Artefakte, die Bücher und Hypertexte dagegen schon. Wenn ich Medien nicht utilitaristisch für den Turmbau nutze, sondern reflexiv, werde ich mir meiner Sprache neu bewusst:
Hypertexte machen dann als Mitteilungen demonstrativ keinen Sinn. Als Hyperautor produziere ich zwar Texte, nämlich Textbausteine, ich mache aber mit den Texten keine Mitteilungen, sondern eine Art Vokabular für surfende Hyperleser, die sich ihren Text durch Anklicken von Links erzeugen. Der Hyperleser produziert zwar den gelesenen Text, aber er macht natürlich auch keine Mitteilungen, denn er liest ja immer seinen eigenen, selbst zusammengestellten Hypertext-Text. Die Arbeit am Text erscheint unter dieser Perspektive als Arbeit an einer "Graphit"-Struktur unter ästhetischen Gesichtspunkten, so wie ein bildender Künstler, etwa ein Bildhauer, mit der Entwicklung seines Gegenstandes verfährt. Texte - und mithin Dialoge - sind Kunstwerke, wenn sie keine Mitteilungs-Funktion haben. Hyperkommunikation ist ein Medium des Ausdrucks, sie dient nicht der frevelnden Erkenntnis, sondern der Selbsterkenntnis, der Erfahrung des dialogischen Eingebundenseins.
[6 Kommentar]
Inhalt
Lob der Meisterschaft - April 6, 2014
 gerade (dank Ralf Keuper) bei T. Jun'ichiro - ganz selektiv und be-LIEB-ig- gelesen:
Die Entschlossenheit, mit der sich die Meister in ihrer Übung einrichten, ganz darauf konzentrieren, sie ohne Rücksicht auf etwas anderes zum Lebensinhalt machen, genau diese Entschlossenheit macht sie zu Meistern.
Meister haben eine recht eingleisige, einfältig-direkte, t(r)ollpatschige Art. Sie verharren auf Jarhzehnte in ihrem eigenen Bezirk und feilen unermüdlich an ihren Fertigkeiten. Sie sind naiv wie Kinder und trotz ihres Könnens ungeschickt im Argumentieren. Sie verlassen sich - besonnen - auf ihre Fähigkeiten.
gerade (dank Ralf Keuper) bei T. Jun'ichiro - ganz selektiv und be-LIEB-ig- gelesen:
Die Entschlossenheit, mit der sich die Meister in ihrer Übung einrichten, ganz darauf konzentrieren, sie ohne Rücksicht auf etwas anderes zum Lebensinhalt machen, genau diese Entschlossenheit macht sie zu Meistern.
Meister haben eine recht eingleisige, einfältig-direkte, t(r)ollpatschige Art. Sie verharren auf Jarhzehnte in ihrem eigenen Bezirk und feilen unermüdlich an ihren Fertigkeiten. Sie sind naiv wie Kinder und trotz ihres Könnens ungeschickt im Argumentieren. Sie verlassen sich - besonnen - auf ihre Fähigkeiten.
[0 Kommentar]
Inhalt
Personalcomputer - April 3, 2014
Als Personalcomputer - oder kurz PC - bezeichne ich Computer für das Personal, das zuvor an Terminals von Mainframes oder Mini- Computern gearbeitet hat.
Dem Marketing des Computerkonzerns IBM ist es gelungen, den Ausdruck "Personalcomputer", der zu einer Typenbezeichnung wurde, praktisch für IBM-PC (und Kompatible) zu monopolisieren. Appel war dann stolz darauf keine PCs sondern Mac's zu produzieren und andere Hersteller bezeichneten ihre PC als Workstation, womit sie den PC überflügeln wollten.
Der Ausdruck "personal" ist ambivalent. Dem deutschen Wort "Personal" entspräche das englische "personell" (staff), was eine ganz andere Bedeutung hat als "persönlich". Die Leute, die die ersten "Klein"computer entwickelt haben, waren Homebrew Nerds, die sich für Technik interessierten - und wohl merkten, dass in dieser speziellen Technik ein Potential lag, das einige von ihnen später in verschieden erfolgreichen Firmen ausschöpften, wie etwa Adam Osborne. Ihr Ziel war ein kosteneffizientes Gerät zu entwickeln.
Nachdem sich durch Apple und andere abgezeichnet hatte, dass Mikrocomputer ein Potential darstellen, ist der Monopolist IBM auch in dieses Segment eingestiegen und hatte dabei seine industriellen Kunden und deren Personal im Focus. Es ging nicht mehr um Freude an der Technik, sondern um "Work", was dann im Ausdruck "Work-Station" nochmals verdeutlicht wurde.
Dass der PC in all den Variationen, die bislang entwickelt wurden, ein Jedermannsgegenstand wie etwa die Armbanduhren oder das Radio würde, hat sich das IBM-Management lange Zeit nicht vorstellen können (und wohl deshalb auch den Markt verschlafen, den sie anfänglich aufgebaut und dominiert hatten. Dass sie die Zeichen der Zeit nicht verstanden hatten, zeigt auch der Microsoftdeal. Es liegt eine gewisse Ironie darin, dass der Personal Computer tatsächlich zu einem „persönlichen Rechner“ geworden ist, der jetzt eben Heimcomputer heisst und im Discountwarenhaus verkauft wird ... wo ich jeweils persönlich einkaufe
Computern gearbeitet hat.
Dem Marketing des Computerkonzerns IBM ist es gelungen, den Ausdruck "Personalcomputer", der zu einer Typenbezeichnung wurde, praktisch für IBM-PC (und Kompatible) zu monopolisieren. Appel war dann stolz darauf keine PCs sondern Mac's zu produzieren und andere Hersteller bezeichneten ihre PC als Workstation, womit sie den PC überflügeln wollten.
Der Ausdruck "personal" ist ambivalent. Dem deutschen Wort "Personal" entspräche das englische "personell" (staff), was eine ganz andere Bedeutung hat als "persönlich". Die Leute, die die ersten "Klein"computer entwickelt haben, waren Homebrew Nerds, die sich für Technik interessierten - und wohl merkten, dass in dieser speziellen Technik ein Potential lag, das einige von ihnen später in verschieden erfolgreichen Firmen ausschöpften, wie etwa Adam Osborne. Ihr Ziel war ein kosteneffizientes Gerät zu entwickeln.
Nachdem sich durch Apple und andere abgezeichnet hatte, dass Mikrocomputer ein Potential darstellen, ist der Monopolist IBM auch in dieses Segment eingestiegen und hatte dabei seine industriellen Kunden und deren Personal im Focus. Es ging nicht mehr um Freude an der Technik, sondern um "Work", was dann im Ausdruck "Work-Station" nochmals verdeutlicht wurde.
Dass der PC in all den Variationen, die bislang entwickelt wurden, ein Jedermannsgegenstand wie etwa die Armbanduhren oder das Radio würde, hat sich das IBM-Management lange Zeit nicht vorstellen können (und wohl deshalb auch den Markt verschlafen, den sie anfänglich aufgebaut und dominiert hatten. Dass sie die Zeichen der Zeit nicht verstanden hatten, zeigt auch der Microsoftdeal. Es liegt eine gewisse Ironie darin, dass der Personal Computer tatsächlich zu einem „persönlichen Rechner“ geworden ist, der jetzt eben Heimcomputer heisst und im Discountwarenhaus verkauft wird ... wo ich jeweils persönlich einkaufe
[0 Kommentar]
Inhalt
Dialog-Computersystem - xx
 Dialog-Computer(system) ist ein umgangssprachlicher Ausdruck - wohl aus der Werbung - der einen wichtigen Aspekt der Computerentwicklung ziemlich undifferenziert bezeichnet. Umgangssprachlich ist mit Dialog gemeint, dass man mit dem Computer irgendwie sprechen kann. Dieses vermeintliche "Sprechen" hat J. Weizenbaum mit seiner Eliza dialektisch entfaltet.
Technologisch sind verschiedene Entwicklungsstufen des Computers im Spiel, die im Ausdruck "Dialog" aufgehoben werden.
1.) bietet das Bildschirm-Terminal ein gewisses Feedback bei der Dateneingabe, was als Antwort im weitesten Sinne gesehen werden kann.
2.) gibt eine Maskenfolge am Bildschirm eine Art Fragen, die beantwortet werden müssen.
3.) gibt eine Menü-Funktion am Bildschirm dem Benutzer die Möglichkeit zwischen verschiedenen Angeboten auszuwählen.
4.) kann die bedingte Anzeige am Bildschirm als Antwort aufgefasst werden. Ich kann etwa die Eingabe "2 + 3" als Frage verstehen und die am Bildschirm ausgegeben "5" als Antwort des Systems dazu.
5.) schliesslich kann die Ausgabe - wie bei Eliza - aus ganzen Sätzen bestehen.
"Dialog-Computer" bezeichnet eine Echtzeit-Reaktion (im Unterschied zu Batch-Verfahren) und eine Form der Ausgabe, die in dem Sinne als interaktiv auf die Eingaben bezogen werden kann, als die Eingaben von den vorgängigen Ausgaben mitbestimmt werden. Natürlich ist das zeitlich stark verzögert bei jedem Computer, also auch bei lochkartengesteuerten Computern der Fall. Die zeitliche Distanz verwischt aber solche Zusammenhänge.
Das umgangssprachliche "Dialog-Computer" bezeichnet mithin eine Deutung eines Phänomens, in welcher ein Computer sprechen kann und in welcher Dialog für ein wechselseitiges Reagieren auf ausgegebene Wörter steht.
Sprachkritisch:
In meiner Sprache sind Dialoge Gespräche und Computer Artefakte, die sich innerhalb einer Technologie als Automaten beschreiben lassen.
Wer mit Computern Dialoge führt, beseelt diese und komplementär entseelt er sich selbst.
Dialog-Computer(system) ist ein umgangssprachlicher Ausdruck - wohl aus der Werbung - der einen wichtigen Aspekt der Computerentwicklung ziemlich undifferenziert bezeichnet. Umgangssprachlich ist mit Dialog gemeint, dass man mit dem Computer irgendwie sprechen kann. Dieses vermeintliche "Sprechen" hat J. Weizenbaum mit seiner Eliza dialektisch entfaltet.
Technologisch sind verschiedene Entwicklungsstufen des Computers im Spiel, die im Ausdruck "Dialog" aufgehoben werden.
1.) bietet das Bildschirm-Terminal ein gewisses Feedback bei der Dateneingabe, was als Antwort im weitesten Sinne gesehen werden kann.
2.) gibt eine Maskenfolge am Bildschirm eine Art Fragen, die beantwortet werden müssen.
3.) gibt eine Menü-Funktion am Bildschirm dem Benutzer die Möglichkeit zwischen verschiedenen Angeboten auszuwählen.
4.) kann die bedingte Anzeige am Bildschirm als Antwort aufgefasst werden. Ich kann etwa die Eingabe "2 + 3" als Frage verstehen und die am Bildschirm ausgegeben "5" als Antwort des Systems dazu.
5.) schliesslich kann die Ausgabe - wie bei Eliza - aus ganzen Sätzen bestehen.
"Dialog-Computer" bezeichnet eine Echtzeit-Reaktion (im Unterschied zu Batch-Verfahren) und eine Form der Ausgabe, die in dem Sinne als interaktiv auf die Eingaben bezogen werden kann, als die Eingaben von den vorgängigen Ausgaben mitbestimmt werden. Natürlich ist das zeitlich stark verzögert bei jedem Computer, also auch bei lochkartengesteuerten Computern der Fall. Die zeitliche Distanz verwischt aber solche Zusammenhänge.
Das umgangssprachliche "Dialog-Computer" bezeichnet mithin eine Deutung eines Phänomens, in welcher ein Computer sprechen kann und in welcher Dialog für ein wechselseitiges Reagieren auf ausgegebene Wörter steht.
Sprachkritisch:
In meiner Sprache sind Dialoge Gespräche und Computer Artefakte, die sich innerhalb einer Technologie als Automaten beschreiben lassen.
Wer mit Computern Dialoge führt, beseelt diese und komplementär entseelt er sich selbst.
[0 Kommentar]
Inhalt
Die Autopoiese der Verwaltung (Politik-Trilogie 3 von 3) - März 26, 2014
 Ein entwickelteres Verständnis der Haushalts-Auffassung von Politik hat ihren dialektischen Ursprung in der als Merkantilismus beschriebenen Welt, in welcher vordergründig private Haushalte von Fürsten in "politische" Haushalte umgewandelt wurden. Dabei geht es nicht wie in der Polis-Geschichte um sozusagen aussenpolitische Bündnisse mit anderen Fürsten, sondern quasi innenpolitisch darum, dass die Verwaltung, die Zölle und Steuern für den Fürsten eintreibt, einen Teil davon am privaten Haushalt des Fürsten vorbeigelenkt, indem sie sich direkt von den Einnahmen bezahlt, und dem Fürsten nur noch gibt, was des Fürsten ist. Das Geld der Verwaltung kommt so nicht mehr in die Kasse des Fürsten und die Beamten werden nicht mehr vom Fürsten bezahlt, obwohl sie für oder im Auftrag des Fürsten arbeiten.
Narrativ hat diese Geschichte zwei Richtungen. Einerseits sind es Beamte, die den Haushalt (Hof) eines Fürsten verwalten und diesem erklären, wie er durch die Verselbständigung der Verwaltung reicher werden könnte. Der Fürst willigt gerne ein und die Sache nimmt ihren Verlauf, beispielsweise als Heldengeschichte wie die der Fugger, die das Zollwesen organisieren und dabei viel reicher werden als jeder Fürst.
Andrerseits sind es Fürsten, die ihren Beamten erklären, wie diese reicher werden könnten, wenn sie nicht mehr aus den Taschen des Fürsten leben. Eine "schöne" Geschichte dazu ist die Erfindung von Elisabeth I., die F. Drake als Freibeuter hervorgebracht hat, der sozusagen auf eigene Rechnung für sie und für England Krieg führte und dabei sein eigenes Geld statt jenes der Königin verlor, während er, solange er mit seinem Sklavenhandel noch Gewinn machte, die Königin, die von seiner Piraterie nichts wusste, beteiligen musste.
Vordergründig geht es um eine Art "Vergesellschaftung" von Verwaltungskosten, vor allem der Kosten der stehenden Kriegs- und Beamtenheere in einem eigenständigen Finanzkreis, in welchem die Verwaltung und die Armee für ihre Aufwände aufkommen und nicht den Haushalt des Fürsten belasten. Eigentlich ist es ein Nullsummenspiel, aber beide Parteien können mit Vorteilen rechnen, wie die beiden obigen Geschichten zeigen. Die Selbstfinanzierung der Verwaltung jenseits der privaten Finanzen des Fürsten bringt eine selbständige Verwaltung hervor, die eben nicht privat, sondern politisch ist. Politisch steht dabei für die Differenz zwischen politisch und privat, wobei politisch jetzt die Verwaltung von nicht Privatem bezeichnet.
Konventionellerweise wird eine andere Geschichte erzählt, in welcher sich die Fürsten bei Bürgern verschulden und so allmählich Mut, Gut und Blut verlieren, während die spartanischen Bürger - die treffender als Bourgoisie bezeichnet werden - den Grundstock des künftigen Kapitals gewinnen. Gerade in England aber, wo das Königshaus immer reicher wurde, entwickelte sich der Kapitalismus zuerst, während die Fugger wie die Medici nur Banker wurden.
Die "politische" Verwaltung hat sozusagen ein eigenes Hoheitsgebiet, das räumlich mit dem Fürstentum übereinstimmen kann, aber eine eigene Konstitution hat, die den Finanzverkehr regelt und durch die Armee sicherstellt, die dann auch nicht mehr dem Fürsten gehört, sondern zunächst eine Art Freibeuterstatus hat, der durch die Verfassung begrenzt wird. Die konstitutive und zugleich generellste Verwaltungsaufgabe besteht in der Herausgabe von nationalem Geld, was als Währung durch die Armee geschützt wird. Das Geld wird politisch, indem es nicht mehr als Siegel des Fürsten dient, sondern von einer Nationalbank verwaltet wird.
Das von den Merkantilisten beschriebene Geld gehört niemandem, es ist Medium im engeren Sinne des Wortes, weil es gedeckt ist. Es könnte von der Nationalbank jederzeit zurückgenommen und vernichtet werden, ohne dass irgend jemand irgendetwas gewinnen oder verlieren würde. Darin motiviert sich der merkantilistische Begriff der politischen Ökonomie.
Als Politik erscheinen so Handlungen, die dazu dienen, Verwaltungsentscheidungen durchzusetzen und die erforderliche Machtbasis für die Durchsetzung sicherzustellen. Die Politiker kontrollieren als Behörden die politische, also die nicht private Verwaltung. Wenn die politische Verwaltung eine hinreichende Stabilität erreicht, so dass sie in einer Verfassung beschrieben werden kann, spreche ich von einem Staat. Der Staat ist eine Nation, wenn eine Nationalbank und mithin eine Währung gegeben ist.
Die grundlegenden politischen Handlungen bezeichne ich als Verstaatlichung und Privatisierung, wobei der Ausdruck Verstaatlichung nicht den Staat meint, sondern die entprivatisierte Verwaltung. Politik heisst der merkantilistische Prozess, der die Verwaltung aus der Obhut von bezeichneten Hausvorständen (Monarchen) herausführt und die Funktion des Hausvorstandes gewährleistet.
Jede Verwaltung verwaltet Finanzen.
Ein entwickelteres Verständnis der Haushalts-Auffassung von Politik hat ihren dialektischen Ursprung in der als Merkantilismus beschriebenen Welt, in welcher vordergründig private Haushalte von Fürsten in "politische" Haushalte umgewandelt wurden. Dabei geht es nicht wie in der Polis-Geschichte um sozusagen aussenpolitische Bündnisse mit anderen Fürsten, sondern quasi innenpolitisch darum, dass die Verwaltung, die Zölle und Steuern für den Fürsten eintreibt, einen Teil davon am privaten Haushalt des Fürsten vorbeigelenkt, indem sie sich direkt von den Einnahmen bezahlt, und dem Fürsten nur noch gibt, was des Fürsten ist. Das Geld der Verwaltung kommt so nicht mehr in die Kasse des Fürsten und die Beamten werden nicht mehr vom Fürsten bezahlt, obwohl sie für oder im Auftrag des Fürsten arbeiten.
Narrativ hat diese Geschichte zwei Richtungen. Einerseits sind es Beamte, die den Haushalt (Hof) eines Fürsten verwalten und diesem erklären, wie er durch die Verselbständigung der Verwaltung reicher werden könnte. Der Fürst willigt gerne ein und die Sache nimmt ihren Verlauf, beispielsweise als Heldengeschichte wie die der Fugger, die das Zollwesen organisieren und dabei viel reicher werden als jeder Fürst.
Andrerseits sind es Fürsten, die ihren Beamten erklären, wie diese reicher werden könnten, wenn sie nicht mehr aus den Taschen des Fürsten leben. Eine "schöne" Geschichte dazu ist die Erfindung von Elisabeth I., die F. Drake als Freibeuter hervorgebracht hat, der sozusagen auf eigene Rechnung für sie und für England Krieg führte und dabei sein eigenes Geld statt jenes der Königin verlor, während er, solange er mit seinem Sklavenhandel noch Gewinn machte, die Königin, die von seiner Piraterie nichts wusste, beteiligen musste.
Vordergründig geht es um eine Art "Vergesellschaftung" von Verwaltungskosten, vor allem der Kosten der stehenden Kriegs- und Beamtenheere in einem eigenständigen Finanzkreis, in welchem die Verwaltung und die Armee für ihre Aufwände aufkommen und nicht den Haushalt des Fürsten belasten. Eigentlich ist es ein Nullsummenspiel, aber beide Parteien können mit Vorteilen rechnen, wie die beiden obigen Geschichten zeigen. Die Selbstfinanzierung der Verwaltung jenseits der privaten Finanzen des Fürsten bringt eine selbständige Verwaltung hervor, die eben nicht privat, sondern politisch ist. Politisch steht dabei für die Differenz zwischen politisch und privat, wobei politisch jetzt die Verwaltung von nicht Privatem bezeichnet.
Konventionellerweise wird eine andere Geschichte erzählt, in welcher sich die Fürsten bei Bürgern verschulden und so allmählich Mut, Gut und Blut verlieren, während die spartanischen Bürger - die treffender als Bourgoisie bezeichnet werden - den Grundstock des künftigen Kapitals gewinnen. Gerade in England aber, wo das Königshaus immer reicher wurde, entwickelte sich der Kapitalismus zuerst, während die Fugger wie die Medici nur Banker wurden.
Die "politische" Verwaltung hat sozusagen ein eigenes Hoheitsgebiet, das räumlich mit dem Fürstentum übereinstimmen kann, aber eine eigene Konstitution hat, die den Finanzverkehr regelt und durch die Armee sicherstellt, die dann auch nicht mehr dem Fürsten gehört, sondern zunächst eine Art Freibeuterstatus hat, der durch die Verfassung begrenzt wird. Die konstitutive und zugleich generellste Verwaltungsaufgabe besteht in der Herausgabe von nationalem Geld, was als Währung durch die Armee geschützt wird. Das Geld wird politisch, indem es nicht mehr als Siegel des Fürsten dient, sondern von einer Nationalbank verwaltet wird.
Das von den Merkantilisten beschriebene Geld gehört niemandem, es ist Medium im engeren Sinne des Wortes, weil es gedeckt ist. Es könnte von der Nationalbank jederzeit zurückgenommen und vernichtet werden, ohne dass irgend jemand irgendetwas gewinnen oder verlieren würde. Darin motiviert sich der merkantilistische Begriff der politischen Ökonomie.
Als Politik erscheinen so Handlungen, die dazu dienen, Verwaltungsentscheidungen durchzusetzen und die erforderliche Machtbasis für die Durchsetzung sicherzustellen. Die Politiker kontrollieren als Behörden die politische, also die nicht private Verwaltung. Wenn die politische Verwaltung eine hinreichende Stabilität erreicht, so dass sie in einer Verfassung beschrieben werden kann, spreche ich von einem Staat. Der Staat ist eine Nation, wenn eine Nationalbank und mithin eine Währung gegeben ist.
Die grundlegenden politischen Handlungen bezeichne ich als Verstaatlichung und Privatisierung, wobei der Ausdruck Verstaatlichung nicht den Staat meint, sondern die entprivatisierte Verwaltung. Politik heisst der merkantilistische Prozess, der die Verwaltung aus der Obhut von bezeichneten Hausvorständen (Monarchen) herausführt und die Funktion des Hausvorstandes gewährleistet.
Jede Verwaltung verwaltet Finanzen.
[0 Kommentar]
Inhalt
Die Polis (Politik-Trilogie 2von 3) - xx
Im na(t)iven Fall referenziert der Ausdruck "politisch" das Buch "Politik" von Aristoteles, in welchem anhand von Verfassungen beschrieben wird, wie in der Polis die Oikos aufgehoben sind, so dass die Polis als verfasster Oikos erscheint.
In der Polis, die Aristoteles als politischen Haushalt beschrieben hat, sehe ich zunächst eine simple Projektion des Umstandes, dass private Haushalte - die die Metapher "Haushalt" spenden - eine kritische Grösse haben, bei welcher sie unrentabel werden, respektive den privaten Pateriarchen überfordern. Solange der Haushalt - in dieser Projektion - ein "Haus" betrifft, das nach innen als Familia einem Pateriarchen - im Sinne der Nemesis - zugerechnet wird, gilt sozusagen ein Naturrecht, nach welchem sich das Haus durch Bewirtschaftung der Natur gedeihend reproduziert. Das "Haus" kann wachsen, indem es weitere Aneignungen macht. Die Grenzen des autopoietischen Wachstum eines Hauses erscheinen als Ressourcenverknappung, also wo bewusst wird, dass jede Aneignung Enteignung ist. Der Pateriarch hat innen- und aussenpolitische Probleme, die er in einer Polis vergesellschaften kann, wenn die Aufhebung des dann als privat erscheinenden Haushaltes in einer Polis günstiger werden als Aneignungen in Form von Unterdrückung nach innen und Krieg nach aussen. Dieses Abwegen wird gemeinhin als Oikonomie bezeichnet, was Lehre vom Haushalt heisst - der nach aussen natürlich wiederum Natur aneignet, bis er auf die nächste Polis trifft. Die Polis ist so gesehen ein rechtlicher Verbund naturrechtlicher Eigentümer von Haushalten, in welchem sich die Eigentümer gegenseitig als solche akzeptieren, solange das die ökonomischste Verhaltensweise ist. Die Polis organisiert diese Akzeptanz, die einerseits durch Teilbündnisse (Parteien) und andrerseits durch ökonomisch beschriebene Übernahmen aufgehoben wird. Bei Aristoteles - der nichts anderes kennt - ist die Polis die notwendige Voraussetzung der Eudaimonia (eu zen, gelingende Lebensführung) und mithin der Sinnhorinzont des menschlichen Leben, das sich innerhalb eines Oikos nicht erfüllen kann. Der Pateriarch jedes Oikos ist notwendigerweise ein politische Individuum, wenn er nicht wie ein Tier oder ein Barbar ausserhalb der politischen Gesellschaft lebt. Die dramatische Version hat Homer entwickelt. Der Troja-Heimkehrer Odysseus tötet die Freier, welche sein Pateriachat "erben" wollten, während er zusammen mit anderen Fürsten weitere Polis erobern wollte, was sich als logistisch aussichtsloses Unterfangen erwies. Die Troja-Geschichte reflektiert, dass die Polis nicht weiter integrierbare Einheiten bilden. O. Höffe beispielsweise wirft Aristoteles vor, dass er keine panhellenische Perspektive habe, was umso erstaunlicher sei, als sie für beide Ziele der Politik notwendig sei: sowohl für das Überleben (zen) der einzelnen Polis, als auch für ihr gelungenes Leben (eu zen). Ich finde diesen Vorwurf erstaunlich oder vielleicht "welt-utopisch" im Sinne einer Supra-Polis, solange wir selbst im nationalistischen (Finanz)Weltkrieg stecken.
Die Vorstellung der Polis als Oikos ist in dem Sinne na(t)iv, als im Oikos nicht getauscht werden muss. Die Polis privater Hausvorstände ist eine Fiktion, in welcher gemeinsame kriegerische Aneignungen geteilt werden, deren Ganzes gösser ist als die Summe der Teile, die die Patrirchen alleine erobern könnten. In seiner reaktionären Vision hat Aristoteles die Polis als ursprünglicher geschildert als die freien Bürger, die sich darin verbinden, weil er erkannte, dass die Polis aufgrund von Vereinbarungen von ursprünglicheren Privaten nicht möglich ist. Die sich verbündenden Hausvorsteher bringen durch ihr Bündnis nicht die Polis hervor, sondern sich selbst als private Subjekte der Polis, die sie jederzeit unterwerfen, wenn sie es können. Die "grossen" Pateriarchen, wie etwa Alexander der Grosse, der eine Art ebenso fiktives Gegenmodell zur Polis geschaffen hat, halten sich eine gewisse Zeit, dies aber ist vor allem ein Resultat von Geschichtsschreibungen. Das Pateriarchat ist seiner Grösse nach an die Reichweite des Pateriarchen gebunden. Deshalb lösen sich die Patriachate in Form ihrer Pateriarchen auf. Alexanders Reich ist wie das alte Rom nie zerfallen, weil es gar nie hinreichend stabil war, dass es zu einem späteren Zeitpunkt hätte zerfallen können. Solche Reiche existierten in den Köpfen ihrer Pateriarchen und verschwanden zusammen mit ihnen, um in der Geschichte verewigt zu werden.
Die Projektion der Polis passt auch sehr gut zur imperialistischen Aussenpolitik der Nationalstaaten, die sich beispielsweise als Commonwealth (of Nations) oder als EU verstehen. Die Polis ist - ebenso wie Aristoteles, der in einer Polis gelebt hat - eine Konstruktion der Re-Naissance, in welcher Nationalstaaten erfunden wurden.
- eine kritische Grösse haben, bei welcher sie unrentabel werden, respektive den privaten Pateriarchen überfordern. Solange der Haushalt - in dieser Projektion - ein "Haus" betrifft, das nach innen als Familia einem Pateriarchen - im Sinne der Nemesis - zugerechnet wird, gilt sozusagen ein Naturrecht, nach welchem sich das Haus durch Bewirtschaftung der Natur gedeihend reproduziert. Das "Haus" kann wachsen, indem es weitere Aneignungen macht. Die Grenzen des autopoietischen Wachstum eines Hauses erscheinen als Ressourcenverknappung, also wo bewusst wird, dass jede Aneignung Enteignung ist. Der Pateriarch hat innen- und aussenpolitische Probleme, die er in einer Polis vergesellschaften kann, wenn die Aufhebung des dann als privat erscheinenden Haushaltes in einer Polis günstiger werden als Aneignungen in Form von Unterdrückung nach innen und Krieg nach aussen. Dieses Abwegen wird gemeinhin als Oikonomie bezeichnet, was Lehre vom Haushalt heisst - der nach aussen natürlich wiederum Natur aneignet, bis er auf die nächste Polis trifft. Die Polis ist so gesehen ein rechtlicher Verbund naturrechtlicher Eigentümer von Haushalten, in welchem sich die Eigentümer gegenseitig als solche akzeptieren, solange das die ökonomischste Verhaltensweise ist. Die Polis organisiert diese Akzeptanz, die einerseits durch Teilbündnisse (Parteien) und andrerseits durch ökonomisch beschriebene Übernahmen aufgehoben wird. Bei Aristoteles - der nichts anderes kennt - ist die Polis die notwendige Voraussetzung der Eudaimonia (eu zen, gelingende Lebensführung) und mithin der Sinnhorinzont des menschlichen Leben, das sich innerhalb eines Oikos nicht erfüllen kann. Der Pateriarch jedes Oikos ist notwendigerweise ein politische Individuum, wenn er nicht wie ein Tier oder ein Barbar ausserhalb der politischen Gesellschaft lebt. Die dramatische Version hat Homer entwickelt. Der Troja-Heimkehrer Odysseus tötet die Freier, welche sein Pateriachat "erben" wollten, während er zusammen mit anderen Fürsten weitere Polis erobern wollte, was sich als logistisch aussichtsloses Unterfangen erwies. Die Troja-Geschichte reflektiert, dass die Polis nicht weiter integrierbare Einheiten bilden. O. Höffe beispielsweise wirft Aristoteles vor, dass er keine panhellenische Perspektive habe, was umso erstaunlicher sei, als sie für beide Ziele der Politik notwendig sei: sowohl für das Überleben (zen) der einzelnen Polis, als auch für ihr gelungenes Leben (eu zen). Ich finde diesen Vorwurf erstaunlich oder vielleicht "welt-utopisch" im Sinne einer Supra-Polis, solange wir selbst im nationalistischen (Finanz)Weltkrieg stecken.
Die Vorstellung der Polis als Oikos ist in dem Sinne na(t)iv, als im Oikos nicht getauscht werden muss. Die Polis privater Hausvorstände ist eine Fiktion, in welcher gemeinsame kriegerische Aneignungen geteilt werden, deren Ganzes gösser ist als die Summe der Teile, die die Patrirchen alleine erobern könnten. In seiner reaktionären Vision hat Aristoteles die Polis als ursprünglicher geschildert als die freien Bürger, die sich darin verbinden, weil er erkannte, dass die Polis aufgrund von Vereinbarungen von ursprünglicheren Privaten nicht möglich ist. Die sich verbündenden Hausvorsteher bringen durch ihr Bündnis nicht die Polis hervor, sondern sich selbst als private Subjekte der Polis, die sie jederzeit unterwerfen, wenn sie es können. Die "grossen" Pateriarchen, wie etwa Alexander der Grosse, der eine Art ebenso fiktives Gegenmodell zur Polis geschaffen hat, halten sich eine gewisse Zeit, dies aber ist vor allem ein Resultat von Geschichtsschreibungen. Das Pateriarchat ist seiner Grösse nach an die Reichweite des Pateriarchen gebunden. Deshalb lösen sich die Patriachate in Form ihrer Pateriarchen auf. Alexanders Reich ist wie das alte Rom nie zerfallen, weil es gar nie hinreichend stabil war, dass es zu einem späteren Zeitpunkt hätte zerfallen können. Solche Reiche existierten in den Köpfen ihrer Pateriarchen und verschwanden zusammen mit ihnen, um in der Geschichte verewigt zu werden.
Die Projektion der Polis passt auch sehr gut zur imperialistischen Aussenpolitik der Nationalstaaten, die sich beispielsweise als Commonwealth (of Nations) oder als EU verstehen. Die Polis ist - ebenso wie Aristoteles, der in einer Polis gelebt hat - eine Konstruktion der Re-Naissance, in welcher Nationalstaaten erfunden wurden.
[0 Kommentar]
Inhalt
Politik-Trilogie (1 von 3) März 9, 2014
Als Politik erscheint vordergründig eine Art Theater, in welchem sich Politiker (Persona, Charaktermasken, Rollenträger) in dem Sinne bekämpfen als sie Parteiinteressen in Machtdispositionen aufheben, die in Legalitäten - vorab in Wahlen oder Geburtsrechten - inszeniert werden.
In dieser Perspektive wird ein Konkurenzverhalten beobachtet, in welchem die Rollenträger ihren Parteiinteressen gemässe Strategien verfo lgen. Von anderen Konkurrenzsituationen unterscheidet sich Politik so gesehen durch ein fiktives Gemeinwohl, in welchem die Parteiinteressen aufgehoben sind, weil alle Parteien das Beste für das ganze Volk wollen. Das "Politische" bezeichnet mithin ein divergentes Interesse am Ganzen, oder negative formuliert, das fingierte Gemeinwohl, das sich durch das Verfolgen eines Parteiwohls einstellt. In diesem Sinne ist A. Smiths unsichtbare Hand ein politisches Motiv.
Die beiden vordergründigen Differenzen zur Politik sind Wirtschaft und Krieg. In der Wirtschaft geht es - in dieser Differenz - um das Wohl des einzelnen Unternehmens, im Krieg tritt anstelle von Macht Gewalt. (siehe auch: Machtpolitik)
Als Politik bezeichne ich (weniger vodergründig) einen Handlungszusammenhang, in welchem "vergesellschaftetes Haushalten" wahrgenommen wird. Innerhalb des gemeinen Haushaltes (als Oikos) gibt es keine gesellschaftlichen Verhältnisse, also weder Tauschwerte noch Verfassungen. Nachdem der Haushalt aber politisch gesehen wird, muss er auch innen verfasst werden, wodurch der gemeine Haushalt indem Sinn privat wird, dass er kein beobachtbares Innen hat, während der politische Haushalt innen und aussen als System und Umwelt unterscheidet. Die Leitdifferenz der Oikonomie ist politisch versus privat, was mitmeint, dass sich der gemeine private Haushalt auch ausdiffenziert, etwa wenn Frau und Kinder Sackgeld als “Lohn” bekommen, was als Spiegelung des Politischen eine Konstitution von Tauschwert impliziert.
lgen. Von anderen Konkurrenzsituationen unterscheidet sich Politik so gesehen durch ein fiktives Gemeinwohl, in welchem die Parteiinteressen aufgehoben sind, weil alle Parteien das Beste für das ganze Volk wollen. Das "Politische" bezeichnet mithin ein divergentes Interesse am Ganzen, oder negative formuliert, das fingierte Gemeinwohl, das sich durch das Verfolgen eines Parteiwohls einstellt. In diesem Sinne ist A. Smiths unsichtbare Hand ein politisches Motiv.
Die beiden vordergründigen Differenzen zur Politik sind Wirtschaft und Krieg. In der Wirtschaft geht es - in dieser Differenz - um das Wohl des einzelnen Unternehmens, im Krieg tritt anstelle von Macht Gewalt. (siehe auch: Machtpolitik)
Als Politik bezeichne ich (weniger vodergründig) einen Handlungszusammenhang, in welchem "vergesellschaftetes Haushalten" wahrgenommen wird. Innerhalb des gemeinen Haushaltes (als Oikos) gibt es keine gesellschaftlichen Verhältnisse, also weder Tauschwerte noch Verfassungen. Nachdem der Haushalt aber politisch gesehen wird, muss er auch innen verfasst werden, wodurch der gemeine Haushalt indem Sinn privat wird, dass er kein beobachtbares Innen hat, während der politische Haushalt innen und aussen als System und Umwelt unterscheidet. Die Leitdifferenz der Oikonomie ist politisch versus privat, was mitmeint, dass sich der gemeine private Haushalt auch ausdiffenziert, etwa wenn Frau und Kinder Sackgeld als “Lohn” bekommen, was als Spiegelung des Politischen eine Konstitution von Tauschwert impliziert.
[0 Kommentar]
Inhalt
Piraten, passt auf !! - Februar 24, 2014
Die Piraten winden sich, weil sie den Bundestag nicht entern konnten, und einige der Deepen-Piraten winden sich ganz besonders, weil genau sie im grossen Kino anzutreffen gewesen wären, wenn sie den Budestag hätten entern können.
Piraten - so interpretiere ich jedenfalls das Wort - wären im Parlament gar keine Piraten. Sie wären Freibeuter wie Francis Drake, der ein ganz übler Pirat war, aber eben nicht als böser Pirat sondern als Vertreter des damaliegen “evil empire”, also mit dem Segen des Parlaments. Aber viele sich jetzt windende Piraten verstehen die Partei ganz offensichtlich nicht als Differenz und ihre Partei mithin nicht als Aufhebung der Partei. Viele Piraten entpuppen sich in Form einer erlebten Niederlage beim Entern als verkleidete Parteipolitiker, die nach Ämtern streben - was ja auch einer Wortbedeutung von Piraterie entspricht: Sie wollten Wählerstimmen “entern” und sind jetzt frustriert, nicht weil die Partei nicht im Bundestag ist, sondern weil sie selbst nicht im Bundestag sind.
Die Piraten - nicht die Freibeuter, die zum System gehören (möchten) - sind eine wichtige Institution. Piraten werden durch eine Partei bedroht, die sie domestizieren will, so wie Söldner vor 500 Jahren zu Soldaten gemacht wurden. Piraten, passt auf !!
[0 Kommentar]
Inhalt
Verantwortungsfrei - Februar 13, 2014
Differenztheoretisch bezeichne ich mit dem Ausdruck “Verantwortung” die Unterscheidung zwischen einer Verantwortung, zu welcher jemand gezogen wird, und einer Verantwortung, die jemand zu übernehmen vorgibt, wenn er weiss, dass er nicht zur Verantwortung gezogen werden kann.
Auf der wortgebende Seite der Unterscheidung heisst Verantwortung, dass ich Antwort geben muss. Im exemplarischen Fall bin ich der Angeklagte vor dem Richter und muss antworten, wo ich die Antwort nicht dem Gutdünken des Richters überlassen will, der seine Antwort so oder so bekommt. Zur Verantwortung gezogen werde ich, wo jemand die Macht hat, mir eine Schuld zuzuweisen und mich zu bestrafen. Dieses Verantworten beruht auf einer Inquisition, in welcher Fragen gestellt werden, damit der zur Verantwortung Gezogene seine relative Schuld explizit bekennt und damit vor allem auch die Machtverhältnisse anerkennt. Die peinlich erzwungene Antworten ist eine Strafe vor der Strafe, die dann folgt, auch wenn die Antwort verweigert wird.
Auf der anderen Seite der Unterscheidung muss ich nie sagen, dass ich Verantwortung übernehme, wo ich ohnehin zur Verantwortung gezogen werden kann. Dagegen kann ich jederzeit sagen, dass Verantwortung übernehme, wo mich niemand zur Verantwortung ziehen kann. Wenn ich sage, dass ich Verantwortung übernehme, postuliere ich für mich eine Machtposition, ungeachtet davon, welche Macht ich wirklich habe. Wo ich tatsächlich Macht habe, muss ich keine Verantwortung übernehmen und nicht einmal davon sprechen.
Das Übernehmen von Verantwortung bezeichnet in diesem Sinne weniger eine Machtposition als vielmehr eine Ungewissheit bezüglich der Machtverhältnisse. Einen dafür exemplarischen Fall erkenne ich in einem politisch gewählten Repräsentant. Seine Wähler können ihm beliebige Fragen stellen, aber sie können ihn nicht zur Verantwortung ziehen. Sie können ihn mit mehr oder weniger Aufwand abwählen. Das betrifft aber den Rollenträger, nicht den Repräsentanten, der dann durch einen anderen Rollenträger ersetzt wird. Was der Repräsentant tut oder lässt, muss und kann er nicht verantworten, weil er es ja anstelle seiner Wähler tut.
Die Differenz zur Repräsentation wiederholt sich in der Unterscheidung zwischen Führer und Diener des Volkes. Politiker, die sich als Füverantwortunghrer sehen, übernehmen oft und gerne Verantwortung. Und Politiker, die sich als Diener des Volkes sehen, können keine Verantwortung übernehmen, weil sie - wie berechtigt auch immer - glauben, dass der Herr seinen Diener fragen könnte. Die Führer unter den Politikern bezeichnen sich selbst, nicht nur weil das Wort Führer politisch seltsam belastet ist, gerne als Manager. Sie invertieren dabei die Differance zum Machtverhältnis in der Manage.
[0 Kommentar]
Inhalt
Ja/Nein-Demokratie - Februar 10, 2014
Nach der Abstimmung zur “Initiative gegen die Masseneinwanderung” könnte ein neues Gespräch aufkommen, eines das die verwendeteten Unterscheidungen reflektiert. Wenn aber weiter wie im Abstimmungskampf diskutiert wird, wird keinerlei Erkenntnis anfallen - ausser die bereits bekannte, wonach die andern die Sache nicht verstehen.
Wenn ich mit jemandem, der mitgestimmt hat, ins Gespräch komme, staune ich immer wieder - nicht darüber, wie, sondern darüber, worüber er meint, abgestimmt zu haben.
Vielleicht ist es ein generelles Problem, aber in dieser Abstimmung ist es mir wieder sehr bewusst geworden. Die Frage, die mit JA/NEIN beantwortet werden muss, hat den Charakter von Watzlawick-Fragen: Ist es wahr, dass Sie Ihren Ehemann nicht mehr mit dem Wallholz schlagen?
Auf dem Stimmzettel kann ich auf solche Fragen nicht reagieren, weil die Anworten vorgegeben sind. JA, ich schlage meinen Mann nicht mehr, aber ich habe es bisher getan, oder NEIN ich schlage ihn immer noch.
Demokratie - was für Parteiendemokratie gerade nicht der Fall ist - würde Gespräche entwickeln, in welchen untersucht würde, was für alle, also nicht für Parteien, schön wäre. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in solchen Gesprächen Fremdenangst/hass eine Rolle spielen würde - und schon gar nicht kann ich mir vorstellen, dass sich einige Gesprächsteilnehmer für die andern schämen würden … Für mich jedenfalls muss sich niemand schämen, auch wenn er JA oder NEIN gestimmt hat
[3 Kommentar]
Inhalt
Allmend und Privatisierung - Februar 1, 2014
Umgangssprachlich wird mit Allmend das von allen oder einzelnen Berechtigten einer Dorfgemeinschaft genutzte Gemeindegut bezeichnet, das nicht zur Deckung der Gemeindeausgaben bewirtschaftet wird. Im nativen Fall der Vorstellung etwa gehört der Wald, in dem jeder Dorfbewohner Holz sammeln darf, zur Allmend. Spezifischer ist ein gemeinsam genutztes Weideland gemeint. Juristisch wird die Allmend als Rechtsform gemeinschaftlichen Eigentums gesehen, also als Gemein- oder Kollektivgut, das für alle potenziellen Nachfrager frei zugänglich ist. Gemeingüter können vom Staat oder wie grosse Teile des WWWs von privaten Anbietern bereitgestellt werden. Hier geht es mir nicht um solche “Allmenden”, obwohl ich sie jenseits von romantischen Vorstellungen in bestimmter Weise mitmeine. Hier geht es mir um die Entfaltung von Eigentum, in welchem die Allmend als potentielles Eigentum aufgehoben ist.
Differenztheoretisch beobachte ich Allmend durch die Differenz zwischen Allmend und Eigentum. Ich verwende den Ausdruck “Allmend” für Sachen, die Eigentum sein könnten, aber keinen Eigentümer haben. Beispielsweise für Strassen, wenn sie nicht wie italienische Autobahnen Eigentum von Aktiengesellschaften oder sogenannte Privatstrassen sind.
Strassen - um im Beispiel zu bleiben - können auch als “öffentliches” oder “kollektives” Eigentum gesehen werden, etwa als Eigentum von politischen Gemeinden, deren Steuerzahler die Herstellung der Strasse bezahlt haben und für deren Unterhalt aufkommen. Es geht mir hier nicht darum zu entscheiden, wem die Strassen inwiefern gehören, sondern darum, dass sie nicht als privatrechtliches Eigentum erscheinen.
Die Allmend, die in der romantischen Interpretation als öffentliche, allen zur Verfügung stehenden Weide erscheint, ist im Mittelalter als jeweilig noch gegen Eigentumsansprüche von Raubadel - das ist ein weisser Schimmel - verteidigte Restweide entstanden. Durch Krieg erobertes Grundeigentum ist konstitutiv für die Bodenallmend. Allmend ist alles, was privatisiert werden will, aber noch nicht privatisiert worden ist. Privatisierenallemnd heisst quasietymologisch etwas rauben oder aus seinem herrenlosen Zustand zu befreien (das latinische “privare”). Privatisieren ist in diesem Sinne eine Enteignung und die gängige Verwendung des Ausdruckes Enteignung bezeichnet die Inversion der Privatisierung.
Wo heute von Privatisierung statt von Enteignung die Rede ist, geht es oft darum, Infrastrukturbereiche wie etwa Spitäler dem Privatrecht zu unterstellen, also um denselben Prozess, durch welchen früher die Weideallmend zu Privateigentum geworden ist. Adliges Raubrittertum in kapitalistischen Rechtsordnungen.
[2 Kommentar]
Inhalt
Was heisst privat? - Januar 29, 2014
Ausdrücke wie “Privatsphäre” begründen viele (Miss)Verständnisse des Ausdruckes “privat”, weil der Teilausdruck “privat” oft nicht als Homonym erkannt wird, das für sehr verschiedene Zusammenhänge steht. Umgangssprachlich wird “privat” für persönlich, eigen, vertraut, familiär, ungezwungen, und für nicht geschäftlich, nicht öffentlich, nicht offiziell, nicht amtlichprivat, nicht staatlich und insbesondere auch für geheim und geschützt verwendet, also dafür, dass die Öffentlichkeit keinen Zugriff auf die gemeinte Sache hat. Natürlich wird privat auch für privat “im eigentlichen Sinn” verwendet, etwa wenn von Privatisierungen gesprochen wird.
Quasi-etymologisch kommt privat vom lateinischen privatus, was ich als “der allgemeinen Bestimmung entzogen” deute, privare hat einen weiten Deutungsraum, wobei herausnehmen und separat stellen meine zentrale Deutung sind. Gemeint ist in diesem Sinne das Ausgliedern von Eigentum aus der Allmend.
Den Ausdruck “privat” verwende ich im Sinne einer Verdinglichung des Privatisierens, womit ich eine Aneignung bezeichne, deren differenzielle Kehrseite eine Allmend erzeugt. (Der Ausdruck “Privatisieren” bezeichnet als metaphorisches Homonym auch ein Leben ohne zu Arbeiten, also ein “Ausgliedern durch Vernichtung von eigenem Vermögen. Hier ist aber mit Privatisieren die Unterstellung unter das Privatrecht, welches Eigentum begründet, gemeint.)
Die primäre Aneignung besteht in der Herstellung von Artefakten. Wenn ich ein Werkzeug herstelle, “gehört” das Werkzeug in diesem naiven Sinne mir. Das Holz oder Metall, dass ich dazu verwende, sehe ich auf einer nicht entwickelten Stufe (sogenannte Jäger und Sammler) als Sammelgut, wie das Wasser aus einem Bach, wie die wilden Früchte im Wald, wie das erlegte Wild, das ich konsumiere, also mir aneigne, ohne dass es zu Eigentum wird, weil es durch die konsumatorische Aneignung sogleich aufgehoben ist.
Das Artefakt überdauert seinen Herstellungsprozess, es liegt danach vor und eröffnet die Möglichkeit von Besitz und Eigentum. Als Mensch bin ich insofern ein toolmaking animal, als ich im Unterschied zu allen mir bekannten Tieren die bewusste Entscheidung treffen kann, wem ein bestimmtes Artefakt gehört, und wer es also rechtens besitzt. Ich kann ein Artefakt beanspruchen oder nicht, was die Differenz zwischen Gesellschaft und Gemeinschaft begründet und dazu führt, dass Menschen als soziale Wesen gesehen werden (können).
Wenn ich ein Artefakt als mein Eigentum betrachte, etwa weil ich es hergestellt habe, kann ich auch gesammelte Nüsse als meine Eigentum sehen, weil ich sie selbst gesammelt habe. Und unter gegebenen Machtverhältnissen kann solches Eigentum in einer Verfassung deklariert werden. Ich kenne aber keinen Fall, wo das je geschehen wäre.
Eine ganz andere Aneignung sind sogenannte Rechte, die förmlich nach Verfassungen rufen. Wenn ich mir ein Stück Boden aneigne, habe ich den Boden weder hergestellt noch gefunden. Die Stückheit des Bodens ist auch nicht gegenständlich begrenzt. Und ich kann den Boden nicht mitnehmen, wenn ich weiterziehe. Die Aneignung von Boden hat die differentielle Kehrseite, dass der Boden vorher schon jemandem gehört hat. Solange kein Stück Boden jemandem gehört, gehört auch die Gesamtheit des Bodens niemandem. Wenn aber jemand seinen Anspruch auf ein Stück Boden durchsetzen kann, wird dieses Stück Boden genau in dem Sinne “privatisiert”, also herausgenommen (privare heisst auch berauben und befreien), wodurch der Rest des Bodens als noch nicht privat erscheint. Die Privatisierung eines Grundstückes konstituiert die Allmend als jenes “Grundeigentum”, das noch niemandem gehört. Die Allmend ist eine differentielle Folge von privaten Grundstücken.
Die ursprüngliche Privatisierung ist quasi naturrechtlich, deren Rollenträger bezeichnet sich selbst als Adel und das Grundstück als royal estate oder Königreich. Als Mittelalter bezeichne ich die Epoche, in welcher handelbare Rechte auf Grundstücke, zuerst wohl Bergbaurechte erfunden wurden, die rückblickend auch auf landwirtschaftliche Nutzungen projiziert wurden. Die entwickeltere Privatisierung besteht darin, dass sich die Rechte nicht mehr auf die Nutzung des Bodens, sondern auf den Boden selbst beziehen. Die bürgerliche Mär erzählt, dass sich der Adel verschuldet und seine Schulden mit Grundstücken abgetragen habe, was gerade ausklammert, wie der Adel je zu den Grundstücken gekommen ist. Das bleibt sozusagen Privatsache oder in der Privatsphäre des Adels.
Als eigentliche Privatisierung bezeichne ich die Unterstellung von Eigentümer unter ein sogenanntes Privatrecht. Das Privatrecht regelt die Verhältnisse zwischen den Eigentümer. Es ist sozusagen der “privatisierte” Teil der Verfassung, die durch das Herausnehmen eines privaten Teils zu einem öffentlichen Recht wird, das Allmenden behandelt. Der Ausdruck “öffentlich” ist dabei quasi synonym zu politisch (im Sinne der politischen Ökonomie) und bezeichnet quasi negativ eine nicht private Zuständigkeit. Das Privatrecht konstituiert das öffentliche Recht, obwohl es im öffentlichen Recht begründet wird.
Öffentlich in diesem Sinne heisst nicht publik, also nicht, dass es für die Öffentlichkeit einsehbar sei, sondern dass die Öffentlichkeit - die durch das Recht bestimmt ist - von diesem Recht betroffen ist. Im Sinne der bürgerlichen Mär stehen das öffentliche und das private Recht für zwei getrennte Bereiche nebeneinander, ganz so, wie wenn ein Staat als entpersonifizierter Statthalter seiner Bevölkerung zwei Ordnungen gegeben hätte. Differentiell geht es aber darum, dass die Allmend ein abgeleitetes Rechtsbedürfnis hat, so dass auch Verhältnisse jenseits von Eigentum geregelt werden können.
Die relative Ordnung zwischen den beiden Rechten ist politisch nicht rechtlich. Das öffentliche Recht beschreibt die politischen Verhältnisse, die das private Recht festlegen.
[0 Kommentar]
Inhalt
Privatsphäre versus privat - Januar 27, 2014
Der Ausdruck “Privatsphäre” begründet viele (Miss)Verständnisse des Ausdruckes “privat”, weil der Teilausdruck “privat” oft nicht als Homonym erkannt wird, das für sehr verschiedene Zusammenhänge steht.
Als Privatsphäre bezeichne ich das Milieu (Um-Welt) einer Person, das dadurch bestimmt ist, dass dessen Grenze verletzt wird, wo andere Personen innerhalb dieses Milieus “Daten erheben”, die sie auf Anfrage nichtprivatsphaere bekommen würden. Als Daten erheben bezeichne ich hier in einem umgangssprachlichen Sinne auch das Hinhören und das Schauen, wodurch noch keine eigentliche Daten, sondern nur - metaphorisch - Daten im Kopf oder im Gehirn des Beobachters entstehen. Bildhaft gesprochen geht es um den sprichwörtlichen Blick durch das Schlüsselloch, was in den Massenmedien durch Paparazzis der Boulevardmedien repräsentiert wird. Die Privatsphäre bildet in diesem Sinne die Sphäre um eine Person herum, für die sich andere Personen in Form von Indiskretionen interessieren.
Einen spezifischen Aspekt der Privatsphäre, der hauptsächlich den sexuell gesehenen Körper betrifft, bezeichne ich als Intimität. Eine verbreitete Verletzung der Intimität besteht in der Veröffentlichung von “intimen” Bildern. Die massivste Verletzung der Intimität ist die Vergewaltigung als spezifische Form von Foltern, die nur in Ausnahmefällen “öffentlich” geschieht, aber vom Standpunkt der Intimität natürlich ein Eingriff von Aussen darstellt, also auch etwas öffentlich macht, weil der Vergewaltiger - auch - sieht, was er nicht sehen soll.
Die Verletzung der Privatsphäre verursacht Scham, wenn die verletzte Privatsphäre durch Moral bestimmt ist. Wenn der nackte Körper zur Privatsphäre gehört, schäme ich mich, wenn ich nackt gesehen werde, und ich schäme mich, wenn ich bei einer Indiskretion beobachtet werde, in welcher andere Nackte von mir gesehen werden. Eine Inversion dieser “privatsphärischen” Nacktheit ist der Exhibitionismus, beispielsweise als Striptease, wo die Privatsphäre sozusagen von innen her aufgebrochen wird.
Die Moral kann nicht nur intime, sondern auch viele andere Verhaltensweisen, die auch rechtlich geregelt sind, umfassen. Ich darf auch aus moralischen Gründen nicht lügen, stehlen oder Drogen verwenden. Wenn ich das in einem relativ geringen Ausmass mache, kann ich das als Handlungen in meiner Privatsphäre sehen und so nicht nur das Recht, sondern auch die Moral aufheben. Und wenn ich dabei durch Indiskretion enttarnt werde, kann ich mich schämen, weil die Moral durch die Indiskretion wieder aktualisiert wird, auch wenn kein Rechtsfall begründet wird.
Die aufgehobene Moral erweitert die Privatsphäre, indem Handlungen in dem Sinne “privatsphärisch” werden, als sie Indiskretionen entzogen sind. Alles, was ich hinreichend geheim halten will und kann, erscheint in dieser pervertierten Form als “privat”, obwohl es mit der Privatsphäre im eigentlichen Sinn nichts zu tun hat, weil die andern nicht einfach aus Neugierde, sondern mit einem begründbaren Anliegen wissen möchten, was ich geheim halte.
Hinweis Die post-privacy-Diskussionen rund um Prism drehen sich weitestgehend um genau diese “Privatheiten”, die weder zur Privatsphäre gehören noch “privat” im eigentlichen Sinne sind. Das Abhören wird durch geheim gehaltene Kriminalität begründet und hört dann leider auch Intimitäten und “Geschäfts”geheimnisse mit, die nicht unbedingt kriminell sind.
Weil bestimmte Geheimnisse als “privat(sphärisch)” bezeichnet werden, gilt in einer Generalisierung jedes Geheimnis als “privat”. Es macht aber keinen, respektive nur einen verschleiernden Sinn, statt von geheim von privat zu sprechen. Ein spezifischer Bezug zwischen privat und geheim besteht bei sogenannten Kavaliersdelikten wie der sogenannten Steuerhinterziehung, die - in der Schweiz beispielsweise - nicht als Betrug behandelt wird, weil sie nur von der Oberklasse betrieben wird. Wenn das Geheimhalten von steuerrelevanten Daten nicht kriminell ist, kann es in einem sehr ambivalenten Sinn der Privatsphäre zugerechnet werden.
Der Schutz der Privatsphäre wird oft aus einem allgemeinen Persönlichkeitsrecht abgeleitet und so auch als Menschenrecht deklariert. Das Menschenrecht schützt die Person, nicht das Private. Vielmehr liegt der Sinn von Menschenrechten gerade darin, die Menschen vor privaten Ansprüchen zu schützen.
Epilog
Eine Inversion der Privatsphäre erkenne ich im Lied “Die Gedanken sind frei”. Sie sind in dem Sinne “frei”, als sie nicht zur Privatsphäre gehören, weil sie anderen als auf gar keine Weise zugänglich gesehen werden. Dabei scheint mir aber nicht die Diskretion das Rätselhafte, sondern vielmehr in welcher Sphäre denn Gedanken sind.
[3 Kommentar]
Inhalt
Spitalpolitik - Dezember 31, 2013
Wenn ich von Spitalpolitik spreche, spreche ich darüber inwiefern und wie Spitäler private oder öffentliche Institutionen sind und inwiefern sie politisch oder ökonomisch geregelt werden. Man kann sich - jenseits staatlicher und historischer Verhältnisse - leicht vorstellen, dass ein Spital wie ein Hotel oder eine Autogarage ein privater Dienstleistungsbetrieb sein könnte, der vollständig von seinen Kunden lebt und nur wenig regulatorische Auflagen erfüllen muss. Historisch sind Spitäler aber im Normalfall Teile eines hochregulierten und subventionierten politischen Systems, das als Gesundheitssystem bezeichnet wird, obwohl es sich mit Krankheit befasst.
In vielen entwickelten Staaten werden öffentliche (und teilweise auch private) Spitäler via Krankenversicherungsgesetze (Obama-care) geregelt.
Aktuell - seit ca. 2000 - im Kanton Zürich
In der föderalistisch konzipierten Schweiz gibt es in Bezug auf Spitäler (wie bei vielem anderen) Bundesgesetze, die von den Kantonen in je eigenen Gesetzen umgesetzt werden. Für das Spitalwesen gibt es eine Revision des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) vom 21. Dezember 2007. Darin werden die Kantone verpflichtet, ihre gesetzlichen Vorgaben für die Spitalplanung und die Spitalfinanzierung zu überarbeiten. So verlangt das neue KVG unter anderem, die freie Spitalwahl für grundversicherte Patientinnen und Patienten zu gewährleisten, ein Finanzierungssystem mit leistungsbezogenen Pauschalen für alle Listenspitäler einzuführen und die Spitalplanung auf den Versorgungsbedarf für Zusatzversicherte auszudehnen.
Die Umsetzung erfolgt dann auf Kantonsebene, im Kanton Zürich beispielsweise durch das Spitalplanungs- und -finanzierungsgesetz (SPFG). Weil die Spitalplanung und Spitalfinanzierung sinnvollerweise aufeinander abgestimmt erfolgen, hat der Kanton Zürich beides in einem Erlass geregelt. Das SPFG wurde vom Kantonsrat am 2. Mai 2011 verabschiedet und für dringlich erklärt. Es ist am 1. Januar 2012 (unabhängig von einem allfälligen Referendum) in Kraft getreten. Am 5. Juli 2011 reichten Stimmberechtigte ein Referendum mit Gegenvorschlag ein. Aufgrund des Referendums kam es zu einer kantonalen Volksabstimmung über das SPFG. Diese fand am 17. Juni 2012 statt. Gemäss den Angaben des Statistischen Amts wurde das SPFG (Hauptvorlage) mit 66,7 Prozent Ja-Stimmen angenommen.
In der Selbstdarstellung des Kantons tönt das so: Das SPFG verzichtet auf planwirtschaftliche Massnahmen und Vorgaben. Es macht die nach dem KVG zwingend vorgeschriebene Bedarfsplanung und -abdeckung in klaren, nachvollziehbaren Schritten für die Spitäler sichtbar. Es definiert die Ziele, die mit der Spitalplanung verfolgt werden, und die Anforderungen, die die Leistungserbringer erfüllen müssen. Diese Regeln sichern die Versorgung der Zürcher Bevölkerung in notwendiger Qualität und zu wirtschaftlichen Bedingungen. Es setzt wettbewerbsstärkende Impulse, unterstützt die freie Spitalwahl und bezieht Privatspitäler vermehrt in die Gesamtversorgung ein.
«Modell 100/0» Das SPFG führte per 1. Januar 2012 zu einer Bereinigung und Entflechtung der Finanzströme im Zürcher Gesundheitswesen. Mit dem Gesetz wurde das «Modell 100/0» umgesetzt. Es schuf eine klare Trennung der Versorgungsverantwortung zwischen dem Kanton und den Gemeinden: Für die Spitalversorgung ist nun ausschliesslich der Kanton verantwortlich, für die Pflegeheime und Spitex sind es ausschliesslich die Gemeinden. Entsprechend übernimmt der Kanton seit Inkrafttreten des SPFG am 1. Januar 2012 den Anteil der öffentlichen Hand an der Spitalfinanzierung zu 100 Prozent, während die Gemeinden ihrerseits die Langzeitpflege neu ohne kantonale Beteiligung finanzieren.
Die Aufteilung (Akut-)Spital und Langzeitpflege ist in vielen Fällen problematisch und ziemlich genau das Gegenteil davon, was im “Modell Affoltern” beschrieben wird.Die Spitäler werden unter dem SPFG zu Quasi-Unternehmen, die unter definierten Bedingungen (Spitalliste, Fallpauschalen) rentieren müssen. Ziel der Regelung ist einerseits die richtige Anzahl Dienstleistungsangebote (zb Spitalbetten) in einer vernünftigen regionalen Verteilung zu erreichen und andrerseits einen optimalen Preis für die Dienstleistungen zu erreichen. Für beides dient ein gesteuerter Markt, in welchem den Spitälern ein Überlebens- und Wachstums-Motiv zugerechnet wird, wie wenn es sich um private Marktteilnehmer handeln würde - was eine unsinnige Voraussetzung darstellt, die aber eine gewisse Logik darin hat, dass bestehende Spitäler als Institutionen, etwa als Arbeitsgeber ein Überlebensmotiv haben, das mit dem Spitalsein nichts zu tun hat.
Die Spitäler fungieren als virtuelle Konkurrenten, die sich in einem Markt behaupten müssen. Da die Spitäler im Normalfall - also von Nischendienstleister abgesehen - immer grosse Defizite zulasten der öffentlichen Hand gemacht haben, waren die Eigentums- oder Rechtsformverhältnisse praktisch ohne Relevanz. Niemand hatte Profit davon Eigentümer eines Spitals zu sein. In dem 80er Jahren des letzten Jahrhunderts hat die Kantonsregierung einige Spitäler geschlossen, um das Überangebot abzubauen. Die Kriterien dafür, welche Spitäler geschlossen werden müssen, waren nicht nachvollziehbar und deshalb politisch heftig umstritten, was die Spitalschliessungen nicht nur kompliziert und teuer machte, sondern auch nicht hinreichend im Umfang. Der Kanton hat deshalb eine andere “Regelung” eingeführt.
Der politische Mechanismus zur Regelung der Spitaldichte besteht aktuell aus einer Kombination von einer Spitalliste und Fallpauschalen, die beide politisch festgelegt werden. Auf der Spitalliste bleiben Spitalabteilungen, die hinreichend viele Fälle mit hinreichendem finanziellen Aufwand bewerkstelligen können. Was hinreichend ist, wird mit Benchmarks festgelegt. Der Kanton kann dann nichts dafür, wenn ein Spital nicht mithalten kann. Die Spitäler schliessen sich selbst, wenn sie die Preise der andern nicht halten können.
Bis zur Inkrafttretung des SPFG hat sich der Kanton an den Investitionen der Spitäler beteiligt, also Geld für Spitäler ausgegeben, so wie er Geld für Strassen ausgibt. Dabei haben verschiedene Spitäler in Abhängigkeit davon, ob sie viel oder wenig ausgebaut haben, mehr oder wenig Geld bekommen. Damit die Spitäler, die jetzt in einem Fallpauschalen-Markt stehen, in Bezug auf Investitionen vergleichbare Ausgangsbedingungen haben, hat sich die Kantonsregierungen einen üblen Trick ausgedacht, der als “Verordnung über die Umwandlung von Investitionsbeiträgen an Spitäler (InUV)” erlassen wurde.
“Umwandlung von Investitionsbeiträgen an Spitäler” Das SPFG sieht vor, dass Staatsbeiträge, die der Kanton vor Inkraftsetzen des Gesetzes zur Finanzierung von Investitionen von Listenspitälern geleistet hatte, zum Restbuchwert per 1. Januar 2012 in zins- und amortisationspflichtige Darlehen umzuwandeln sind. Dazu hat der Regierungsrat am 5. Oktober 2011 die Verordnung über die Umwandlung von Investitionsbeiträgen an Spitäler (InUV) erlassen. Sie regelt zum einen das Verfahren und zum andern die Verzinsung, Amortisation und Sicherung solcher Darlehen.
Durch diese Verordnung hat der Kanton das Geld, das er definitiv ausgegeben hat, im Nachhinein in Darlehen “umgewandelt”. Die “Umwandlung” ist keine Umwandlung, sondern ein kriminelles Stück, in welchem das Geld zurückverlangt und dann als Darlehen gegeben wird. Die Spitäler hatten auf diese Weise über Nacht grosse Schulden beim Kanton. Und weil viele Spitäler, wie etwa das Spital Affoltern als Zweckverband gar nicht vermögens- und mithin auch nicht schuldenfähig war, hat der Kanton diese Darlehen einfach den Gemeinden des Zweckverbandes aufgebürdet.
Diese absolut unglaubliche “Umwandlung, die jenseits von jedem Rechtsverständnis liegt, hat der Kanton mit folgender Argumentation durchgesetzt. Die Spitäler würden durch die Fallpauschalen Investitionsgelder vom Kanton bekommen und könnten so die vermeintlichen Darlehen, die sie auch vom Kanton bekommen haben, dem Kanton zurückzahlen. Durch diesen Trick wollte der Kanton die ungleichen Investitionsbeiträge an verschiedene Spitäler ausgleichen. Was neben dem sehr fraglichen Ausgleich tatsächlich gemacht wurde, ist eine Kapitalisierung der Spitalanlagen, die zuvor Allmende waren und durch die “Umwandlung” plötzlich als Hypotheken gesehen werden. Ein Spitalgebäude etwa, das in keiner Art und Weise dem Kanton gehörte und vollständig bezahlt war, wird durch diese sogenannte Umwandlung im Nachhinein mit einer Hypothek belastet, für die der Kanton keinerlei Geld ausgibt. Weil in der - fiktiv ausgedachten - Buchhaltung des Spitals plötzlich eine grosse Hypothekarschuld erscheint, muss auf der andern Seite die Liegenschaft plötzlich einen entsprechenden Betrag Anlagevermögen oder eben Kapital wert sein.
Mit dieser Kantonslogik könnte natürlich jeder, der je etwas an das Spital bezahlt hat, dieses Geld im Nachhinein als Darlehen bezeichnen. Insbesondere die Gemeinden, die erhebliche Beiträge an das Spital bezahlt haben, könnten diese Gelder auch plötzlich als Darlehen sehen und damit die Hypotheken des Spitals entsprechend vergrössern. Da dem Spital dadurch aber eine Zinslast entstehen würde, die er mit den gegebenen Fallpauschalen bei weitem nicht aufbringen könnte, müssen die Gemeinden auf diese Kapitalisierung verzichten, weil sie so das Spital schliessen würden - wie der CEO des Spitals, dem diese Problematik sehr bewusst ist, mehrfach hervorgehoben hat.
Eine vermeintlich elegante Lösung hat die Betriebskommission darin gesehen, das Spital in eine Aktiengesellschaft “umzuwandeln”. Auch diese Umwandlung ist ein übler Trick, bei welchem das Spital, das niemandem gehört, einer AG geschenkt worden wäre. Dabei hätte man das Spital privatisiert, gleichgültig wer die Aktien bekommen oder sich angeeignet hätte. Wenn sich eine Gemeinde an einer AG beteiligt, verändert sie die AG als private Institution in keinster Weise. Die AG wäre Eigentümer des Spitals geworden und hätte in ihrer Buchhaltung das Spital als Vermögen ausgewiesen. Die Aktionäre hätten dieses Vermögen “einbezahlt” ohne irgend etwas zu bezahlen - es sei denn, sie hätten wie der Kanton, Gelder die früher bezahlt wurden, plötzlich zurück verlangt, um damit dann Aktien zu kaufen.
Im Zweckverband, so wie dieser von der Verfassung gemeint war, gibt es kein Vermögen. Natürlich kann man das Spital als Liegenschaft und dessen Einrichtungen privatisieren und so zu Eigentum machen. In unserer Geschichte haben das viele Allmenden erlebt und es ist absehbar, dass diese Aneignungen weiterhin verfolgt werden. Dass der Zweckverband bisher ohne Haushalt auskommen musste, war eine sehr bewusste Wahl. Und wenn jetzt der Zweckverband einen Haushalt bekommt, was die Spielchen des Kantons irgendwie nötig machen, weshalb der Kanton die Gesetze einfach angepasst hat, dann stellt sich immer noch die Frage, wer aufgrund von was Eigentümer des Spitals sein soll.
Dass die zuständigen Juristen diesbezüglich ziemlich konfus waren, zeigt sich auch darin, dass die Spitalliegenschaft im Grundbuch als Eigentum des Spital eingetragen ist, obwohl das Spital bislang gar kein Eigentum haben kann. Diese Konfusion ist aber unerheblich, solange man das Spital nicht als Vermögenswert sondern als öffentliche Institution betrachtet. Die Gemeinden könnten ohne weiteres auf dubioses Eigentum am Spital verzichten, auch wenn der Zweckverband mit einem Haushalt ausgestaltet wird.
Die Statuten sagen, dass die Gemeinden ein allfälliges Defizit zu tragen haben, sie sagen nicht, dass das Spital in irgendeiner Weise Eigentum der Gemeinden ist. Wenn das Spital sich selbst gehört, ist es gut aufgestellt und kann sich vielleicht sogar das angestrebte Bettenhaus leisten. Dass die Gemeinden in der Verantwortung für das Spital stehen, bewirkt, dass das Spital wesentlich bessere Kreditkonditionen bekommt, als es eine AG je bekommen hätte. Die Änderung der Zweckverbandsstatuten sollte gut bedacht werden. Die Luft, die wir atmen, ist auch wertvoll und gehört (vorderhand) niemandem. Auch das Spital braucht keine Eigentümer.
[14 Kommentar]
Inhalt
Konversation als Utopie - November 6, 2013
Die Konversation als Kultur des Salons hat ein sittenstrenges Protokoll, das regelt, wie gesprochen wird. Eine grundlegende Differenz erkenne ich zwischen Regeln als Gebot und Regeln als Vision. Die Regeln der Konversation sind keine Vorschriften, die jemand einhalten müsste. Das würde nicht nur der Konversation prinzipiell widersprechen, sondern auch einer Salonveranstaltung, deren Sinn auch im Ausloten von Regeln liegt. Die Regeln müssen nur in einem bestimmten Sinn eingehalten werden, sie müssen als solche aufrechterhalten werden, gleichgültig wie oft sie auf welche Weise verletzt werden. Die Regelverletzungen müssen als Ausnahmen wahrgenommen werden können oder wo das nicht mehr gelingt, als Antrag, die Regeln zu ändern. Regelverletzungen werden in keiner Weise geahndet, sie werden als Anlass genommen, die Regel zu bedenken. Die Regeln beschreiben als Vision, wie ich sprechen möchte, wie ich sprechen werde, wenn ich als Mensch entwickelt bin. Wenn ich die Einträge auf den Steintafeln von Moses als solch utopische Regeln lese, lese ich nicht, Du sollst nicht lügen, rauben und töten, sondern die Verheissung, Du wirst nicht lügen, rauben und töten, wenn Du ein Mensch geworden bist. Die Regeln des Protokolls beschreiben nur sozusagen die Zukunft, sie beschreiben als Utopie die Gegenwart der Gemeinschaft.
Ein paar einfache Regeln beschreiben etwa, dass ich Ich-Formulierungen verwende und in die Mitte spreche. Ich spreche nicht zu, sondern mit Menschen. Ich sage nichts, was andere wissen müssen, sondern ergründe, was wir gemeinsam erkennen können. In der Konversation versuche ich nicht zu überzeugen, was von andern bezeugt wird. Ich bezeuge, was ich für-wahr-nehme. Die für mich grösste Herausforderung besteht gerade darin, etwas anderes als andere zu sagen, ohne dies als ihnen zu widersprechen zu begreifen. In der Konversation muss ich auf eine radikale Weise bei meinen Vorstellungen sein, weil ich nur so den Respekt gegenüber konversen Vorstellungen nicht verletze, also nicht in Kompromissen auflöse.
Die Regeln lassen sich als eine Art Absicherung verstehen, als ein Behältnis, innerhalb dessen ich ohne Vorsicht und ohne Rücksicht über meine Vorstellungen sprechen kann. Was mir in einer Diskussion als Widerspruch erscheint, verstehe ich in der Konversation als komplementäre Auffassung, die Reichtum erschliesst, weil von allem, was von Herzen gesagt wird, nichts ausgeschlossen wird. Eine grundlegende Funktion der Regeln sehe ich darin, noch nicht entwickeltes oder gefährdetes Vertrauen zu überbrücken. Ich brauche beispielsweise in der Konversation eine Art Vertrauen, welches mir das Aushalten von Aussagen ermöglicht, die ich nicht sofort verstehen kann. Ich muss auch Aussagen aushalten, die mir falsch, abwegig oder politisch nicht korrekt erscheinen. Wenn ich genügend Vertrauen entwickelt habe, kann ich Bewertungen zurückstellen, so wie ich es unter meinen engsten Freunden kann. Ich kann erwarten, wohin die gemeinsame Reise gehen wird.
[0 Kommentar]
Inhalt
Das Konversationslexikon als Inversion der Konversation - November 2, 2013
In den Konversationssalons der Renaissance trafen sich Habitués, die es schafften, von der Salonière eingeladen zu werden. Sie mussten sich dabei den gebotenen Spielregeln unterstellen, die die jeweilige Konversation bestimmten. Antje Eske hat viele solche Spiele, die sie als Salonière pflegt, beschrieben. Sinn all dieser Spielregeln ist für mich, die Konversation von Argumentationen des Common Sense zu befreien, damit im Fluss des Sprachspieles Zusammenhänge sichtbar werden, die durch den Common Sense tabuisiert werden.
IIch will hier ein spezielles Spiel beobachten, dass ich als Konversation im engeren Sinne bezeichne. Es geht in diesem Spiel zunächst darum, konverse Worte zu finden. Konvers sind Worte in Relation zu anderen Worten, wenn man mit Hilfe der je beiden Wörtern zwei unterschiedliche Äußerungen mit gleicher Bedeutung bilden kann. Die Ausdrücke „Vorfahre“ und „Nachkomme“ haben in diesem Sinne konverse Bedeutungen, als jemand genau dann Vorfahre eines anderen, wenn der andere sein Nachkomme ist. In diesem Spiel geht es darum, die Sichtweisen zu erkennen, die mit gewählten Wörtern verbunden sind, also darum, dass die Sichtweise ihre Sprache hat, und dass die verwendete Sprache eben eine Perspektive - im Beispiel nur vorwärts oder rückwärts schauen - impliziert.
IDas Konversationsspiel, das ich anspreche, verlangt von mir, dass ich mir bewusst mache, in welcher Perspektive ich meine Worte verwende. Ich begreife dabei jedes Wort als Er-Satz für einen Satz, den ich anstelle des Wortes sagen könnte. Im Spielmodus schreibe ich beispielsweise ein Wort auf ein Blatt Papier, das ich weiterreiche. Der nächste Spieler klappt das Wort weg und schreibt stattdessen den Satz, durch den er das Wort ersetzt. Der wiederum nächste Spieler klappt diesen Satz weg und schreibt ein Wort, mit welchem er den Satz ersetzt, usw. Die Sätze entstammen einem individuellen Sprachgebrauch, da sie aber als geschrieben Sätze vom jeweiligen Schreibenden abgelöst sind, erscheinen sie als Definitionen, die in einem Wörterbuch stehen könnten. In der Konversation erscheinen sie als konverse Formulierungen, in welchen ich in einem Wort dasselbe sage, wie ich in einem Satz mit vielen Worten auch sagen kann. Als Vorfahre bezeichne ich beispielsweise jemanden, dessen Nachkomme ich bin.
IDie Konversation dient dazu, eine Vielfalt der Sichtweisen zu erzeugen. M. Foucault hat in seiner Diskurstheorie über Sexualität und Wahrheit eine Inversion der Konversation dargestellt. Die viktorianische Prüderie, die das Sprechen über Sexualität verbietet, erscheint als autoritäre Konversationsregel, die praktisch erzwingt, neue Sichtweisen auf die Sexualität zu generieren, weil sie thematisiert werden muss, aber in der naheliegenden Weise nicht thematisiert werden darf. Die Konversation verwendet anstelle autoritärer Sitte Spiele, um zu anderen Sprech- und Sichtweisen für dieselbe Sache zu kommen.
IDie Salonkonversation scheiterte zuerst daran, dass das Spiel als Ergebnisspiel statt als Prozessspiel gesehen wurde. Das Spiel hat Regeln, die man befolgen muss. Das heisst, man kann das Spiel richtig oder falsch spielen. Aber die Ergebnisse des Spieles werden in keiner Weise richtig, wenn das Spiel richtig gespielt wird. Die Renaissance hat zwei verschiedene Arten entwickelt, mit dem Problem der Richtigkeit umzugehen. Eine Form besteht darin, die Richtigkeit des Ergebnisses zu vermeiden, indem das Ergebnis als Kunst gesehen wird. Dazu hat der Salon die Kunst überhaupt erfunden. Viele Spiele sind so angelegt, dass die Ergebnisse gar keine Art von Richtigkeit enthalten können, während die Spielregeln beliebig anspruchs- und kunstvoll sind. Kunst besteht darin, das Spiel auf hohem Niveau zu spielen.
IDie Aufklärung hat aber auch einen anderen Umgang mit Richtikeit erfunden: das Konversationslexikon, in welchem die „richtigen“ Ergebnisse des Konvers-Spieles für diletantische Habitués im höfischen Adel gesammelt wurden. Wer sich im Salon nicht blamieren wollte, studierte das Konversationslexikon, das als Enzyklopädie die richtige Sprechweise für jede gegebene Sache enthielt. Man kann annehmen - und das wird in der Literatur auch oft getan - dass das Konversationslexikon als Mittel der Konversation entwickelt wurde. Die Konversation verlangt in dieser Auffassung ein gewisses Wissen, das in Lexika zusammengetragen wurde. Die erfolgreichsten Enzyklopädisten, die sich mit zusammengestohlenen Inhalten ein grosses Einkommen schafften, waren Denis Diderot und Jean Baptiste le Rond d’Alembert. Sie bezeichneten ihr Konversationslexikon in der hier gemeinten Inversion als Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, womit sie sich - was eben als Renaissance erscheint - an griechische Vorbilder anlehnten, etwa an Speusippo, der als Leiter der platonschen Akademie ein Enzyklopädie des mittlerweile als vollständige Idiotie erkannten Common Sense als wirklichem Wissen geschrieben hat. Unklar ist mir, ob Diderot und d’Alembert die Kunst als Kunst meinten oder eher wie das Handwerk als noch nicht richtig richtig.
IDas Konversationslexikon erscheint so als Sammlung von Definitionen, die ich kennen muss, wenn ich mich an dieser invertierten Konversation, die dann Wissenschaft genannt wird, beteiligen will.
IDie Konversation lässt sich nach dieser Inversion natürlich erneut invertieren, sonst wäre sie ja ausgestorben. In der Konversation setze ich dann voraus, dass das Wissen in der Enzyklopädie - die heute ja als Wikipedia den Geist zu terorisieren versucht - als zu hinterfragender Common Sense erscheint, in welchem sprecherunabhängige Allgemeinplätze festgeschrieben sind. In der erneuten Inversion geht es darum, konverse Formen zu den Lexikoneinträgen zu finden. Es geht zunächst wieder darum, durch andere Formulierungen dasselbe zu sagen und dabei die Perspektiven des Sprechenden zu erkennen. Wenn ich erkenne, dass ich alternative Redeweisen finden kann, kann ich reflektieren, wie die vermeintliche Sache, über die ich spreche, konstituiert wird. Die neue Spielregel dieser Konversation heisst beispielsweise: finde Deine eigenen Formen konvers zum Lexikon. Schreib Dein eigenes Lexikon, erkenne Deine Sprache, damit Du dem Common Sense nicht ausgeliefert bist.
Die Konversation als Gespräch, das auf Richtigkeiten der Aussagen verzichtet, schafft Raum zum gemeinsamen Nachdenken darüber, wie wir es gerne haben würden. Im Salon vor der sogenannt französischen Revolution wurde oft darüber nachgedacht, wie Menschen sinnvoll zusammenleben könnten. Die Beachtung der Spielregeln, die heute oft als Höflichkeiten interpretiert werden, dienen meiner Erfahrung nach genau dazu, dass niemand, der sich einbildet, er wisse, dieses sagen kann. Konvers bedeutet: sag es doch einmal anders, damit wir es auch anders sehen können!
[ 0 Kommentar]
Inhalt
Konversation der Differenz - Oktober 27, 2013
Die Konvers(ation) verstehe ich als aufzuhebende Differenz. Als konvers bezeichne ich Perspektiven, die ich verwende, um die Einheit einer Differenz so aufzuheben, dass ich sie zur Sprache bringen kann. Kaufen und verkaufen ist von verschiedenen Seiten gesehen dasselbe, das ich auch als Tauschen begreifen kann. Während im Tausch beide Seiten dasselbe tun, bringe ich durch die Konversion eine Differenz ins Spiel, die ich mir in der Konversation bewusst mache. Die Konversation lebt davon, dass Perspektiven eingebracht werden, ich sehe Dich, Du siehst mich, wir sehen verschieden, obwohl wir uns betrachten.
Konversationen sind zwar Gespräche, aber keine Zwiegespräche oder Diskussionen. In der Konversation unterscheide ich zwischen Ich und Du, damit ich die Beziehung, die Art, wie Ich und Du in der Einheit einer umfassenden dialogischen Kultur zusammen gehören, dia logos zur Sprache bringen kann. Indem ich die analytische Differenz eines perspektivischen Ichs erzeuge, kann ich über die Einheit in Form von Beziehungen zwischen Ich und Du sprechen. Die in diesem Gespräch gemeinten Beziehungen zwischen Ich und Du sind nicht wechselseitig, sondern eine Einheit. Sie werden lediglich in dialektischer Rede konvers entfaltet. In der Konversation höre ich, wie ich diese Beziehungen auch formulieren könnte, weil andere sie so formulieren. In der Konversation erkenne ich dia logos, also durch die Formulierung hindurch, wo ich wie aufgehoben bin.
In der Konversation geht es mir also gerade nicht darum, jemandem etwas mitzuteilen, sondern darum, etwas zu teilen. Wenn ich mitteile, behandle ich mein Gegenüber als Es, ich konfiguriere oder informiere Es. Ich entscheide, was mein Gegenüber wissen muss. Im aufgehobenen Mitteilen der Konversation habe ich gar kein individualisiertes Gegenüber, das ich informieren könnte. Ich nehme zwar perspektivisch Personen wahr, aber ich nehme sie als persona eines Du. Wo ich zum Du spreche, idealtypisch beispielsweise im Gebet, reproduziere ich keine Information über die Welt, sondern spreche über mein Wahrnehmen unserer Beziehung. Dein Reich komme, es ist das eine Reich, das wir konvers entfalten.
In dieser Entfaltung begreife ich mein Ich (also mich) als Ausdrucksweise einer Inkarnation. Ich strebe dabei nicht nach einer Selbstfindung oder Selbstverwirklichung eines Ichs, sondern danach, das Ich oder das Selbstbewusstsein als Mittel des Dialoges zu erkennen. Es geht mir nicht darum, individuelle Subjekte zu verstehen, sondern darum, den Sinn zu erkennen, der hinter dem Sprechen liegt, das die Subjekte erst hervorbringt. Verstehen bedeutet in dieser Differenz nicht an die Stelle des andern zu stehen, also ihn oder seine Worte zu verstehen. Verstehen heisst die Offenbarung des Sinns zu sehen. In der Konversation mit dem Du muss ich verstehen, was ich sage, ich muss meine Worte verstehen. Das Du, das ich anspreche, weiss - wie jenes, das ich im Gebet anspreche - immer schon und antwortet nicht mit Wörtern. Ich will nicht (be)lehren, denn lehrend beziehe ich mich auf Realitäten, die mir so wichtig scheinen, dass ich sie mitteilen muss. Dabei zeige ich keinen Respekt vor dem Du und der konversen Sicht.
Wo wir gemeinsam denken und sprechen, liegt die Vorstellung nahe, dass wir ein gemeinsames Verständnis anstreben oder gar erreichen könnten. In der Konversation baue ich aber auf einer Gemeinsamkeit auf, ich habe sie nicht als Ziel.
Die Gemeinsamkeit ist in der Konversation bereits gegeben, bevor irgendetwas geäussert wird. Ich spreche nicht zu Menschen, die mir gegenüber stehen, sondern mit Menschen, die die Du-Ich-Unterscheidung als Ausdrucksform der Gemeinschaft mit mir teilen.
[16 Kommentar]
Inhalt - weiter
 Ich kann statt meiner Hände eine Schale verwenden - was mir dann auch zeigt, warum ich davon spreche, dass ich mit meinen Händen eine Schale forme. Ich kann beispielsweise eine hohle Fruchtschale verwenden oder eine hergestellte (artefaktische) Schale.
Jede hergestellte Schale ist bewusst geformtes Material. Ich kann beispielsweise mit meinen Händen eine Schale aus Lehm formen, was etwas ganz anderes ist, als mit den Händen eine Schale zu formen.
Die hergestellte Schale hat eine Gegenstandsbedeutung, die ich erkenne, wenn ich sie als Schale verwende. Die Schale ist in diesem Sinne eine konservierte Anweisung für ein Verfahren, das ich als Schöpfen bezeichne.
Die Schale mittels der Hand zu verwenden, ist in vielen Fällen nicht effizient. Deshalb wird sie oft in Maschinen, beispielsweise in Wasserschöpfeinrichtungen oder in Baggern eingesetzt.
Und natürlich sind auch Maschinen nicht sehr effizient, wenn man sie von Hand steuern muss. Deshalb verwende ich lieber geregelte Maschinen, also Automaten.
Als Technik bezeichne ich mithin einen Handlungszusammenhang, in welchem Verfahren in Artefakten aufgehoben werden.
Im Kontext der ökonomischen Produktion dient die Technik der materiellen Verbesserung des Wohlstandes oder anders ausgedrückt, dem Erübrigen von Arbeit. Ein Roboter kann einen Arbeiter ersetzen, ein PC kann eine Sekretärin zehn Mal schneller machen. "Technik = Arbeit sparen" sagte Ortega y Gasset, (Ropohl, 1979:197)
Im Kontext der Theorie sehe ich den Sinn der Technik in der Entwicklung der Technologie, also in der Entwicklung des Wissens darüber, was wie funktioniert. Die Entwicklung von immer komplizierteren Mechanismen erlaubt die Erklärung von immer komplexeren Phänomenen.
Die Technologie im engeren Sinn beschreibt die Entwicklung der Technik und gibt umgekehrt als Theorie auch eine kategoriale Logik, durch welche ich diese Entwicklung rekonstruiere. Die bislang entwickelste Technik sind Automaten wie Computer, deren Technologie ich als Kybernologie bezeichne, weil ich den spezifischen Aspekt dieser Technik als Kybernetik bezeichne.
Auf der Entwicklungsstufe der Kraftmaschinen erscheint die Technologie noch in den sogenannten Naturwissenschaften, etwa in der Thermodynamik aufgehoben. Erst auf der Stufe der Automaten hat sich die Technologie als Engineering - etwa als Informatik - von den Naturwissenschaften getrennt.
Als Technologie im weiteren Sinn verstehe ich Auffassung (die ich gerne teile), wonach sich der Mensch als toolmaking animal begreifen lässt, wie B. Franklin und nach ihm K. Marx geschrieben haben, um die Wichtigkeit der der Werkzeugentwicklung in ihren Selbstverständnissen hervorzuheben. Das Primitive des Neandertalers waren seine Werkzeuge.
Ich kann beim Gattungswesen Mensch (toolmaking animal) keine wesentliche Entwicklung erkennen, ich erkenne aber leicht, dass die Gattung ihre Technik und mithin ihre Technologie entwickelt. Die "alten" Griechen waren wohl mindestens so intelligent und beweglich wie ich, aber sie hatten keine Computer und deshalb natürlich auch kein Wissen über Computer. Ich - und andere Menschen, die nicht im unberührten Urwald oder in sogenannten Entwicklungsländern leben - scheinen allenfalls entwickelter, weil wir eine entwickeltere Technik (zur Verfügung) haben. Insofern die Werkzeugherstellung ein Gattungskriterium ist, hatten (tauto)logischerweise bereits die ersten Menschen Werkzeuge, wenn auch sehr primitive. Die menschliche Gattung enwickelt nur ihre Technik, Tiere entwickeln sich - von Genmutationen abgesehen - gar nicht.
Aristoteles lebte in einer Epoche der antiken Polis, in welcher die Werkzeuge noch von Sklaven benutzt wurden. Aristoteles entwickelt deshalb sein Geschlecht nicht im Umgang mit Werkzeugen, sondern politisch im Umgang mit Sklaven. Deshalb schien ihm der Menschen ein politisches Tier. B. Franklin, dagegen war als einer der Begründer der USA ein Yankee, der Werkzeuge und Maschinen anstelle der Sklavenhaltung setzen wollte, deshalb sah er das toolmaking animal. Und unabhängig von den beiden, neigt die Geschichtsschreibung dazu, ihre Epochen anhand der Entwicklung der Technologie einzuteilen. In diesem - etwas tierischen - Sinne würde ich allenfalls sagen, der Mensch unserer Epoche ist ein systemerzeugendes Tier.
Ausblick
Ich werde später etwas zur Kybernet-ik schreiben und diese als Teil der Technik von der Kyberno-logie unterscheiden.
Ich kann statt meiner Hände eine Schale verwenden - was mir dann auch zeigt, warum ich davon spreche, dass ich mit meinen Händen eine Schale forme. Ich kann beispielsweise eine hohle Fruchtschale verwenden oder eine hergestellte (artefaktische) Schale.
Jede hergestellte Schale ist bewusst geformtes Material. Ich kann beispielsweise mit meinen Händen eine Schale aus Lehm formen, was etwas ganz anderes ist, als mit den Händen eine Schale zu formen.
Die hergestellte Schale hat eine Gegenstandsbedeutung, die ich erkenne, wenn ich sie als Schale verwende. Die Schale ist in diesem Sinne eine konservierte Anweisung für ein Verfahren, das ich als Schöpfen bezeichne.
Die Schale mittels der Hand zu verwenden, ist in vielen Fällen nicht effizient. Deshalb wird sie oft in Maschinen, beispielsweise in Wasserschöpfeinrichtungen oder in Baggern eingesetzt.
Und natürlich sind auch Maschinen nicht sehr effizient, wenn man sie von Hand steuern muss. Deshalb verwende ich lieber geregelte Maschinen, also Automaten.
Als Technik bezeichne ich mithin einen Handlungszusammenhang, in welchem Verfahren in Artefakten aufgehoben werden.
Im Kontext der ökonomischen Produktion dient die Technik der materiellen Verbesserung des Wohlstandes oder anders ausgedrückt, dem Erübrigen von Arbeit. Ein Roboter kann einen Arbeiter ersetzen, ein PC kann eine Sekretärin zehn Mal schneller machen. "Technik = Arbeit sparen" sagte Ortega y Gasset, (Ropohl, 1979:197)
Im Kontext der Theorie sehe ich den Sinn der Technik in der Entwicklung der Technologie, also in der Entwicklung des Wissens darüber, was wie funktioniert. Die Entwicklung von immer komplizierteren Mechanismen erlaubt die Erklärung von immer komplexeren Phänomenen.
Die Technologie im engeren Sinn beschreibt die Entwicklung der Technik und gibt umgekehrt als Theorie auch eine kategoriale Logik, durch welche ich diese Entwicklung rekonstruiere. Die bislang entwickelste Technik sind Automaten wie Computer, deren Technologie ich als Kybernologie bezeichne, weil ich den spezifischen Aspekt dieser Technik als Kybernetik bezeichne.
Auf der Entwicklungsstufe der Kraftmaschinen erscheint die Technologie noch in den sogenannten Naturwissenschaften, etwa in der Thermodynamik aufgehoben. Erst auf der Stufe der Automaten hat sich die Technologie als Engineering - etwa als Informatik - von den Naturwissenschaften getrennt.
Als Technologie im weiteren Sinn verstehe ich Auffassung (die ich gerne teile), wonach sich der Mensch als toolmaking animal begreifen lässt, wie B. Franklin und nach ihm K. Marx geschrieben haben, um die Wichtigkeit der der Werkzeugentwicklung in ihren Selbstverständnissen hervorzuheben. Das Primitive des Neandertalers waren seine Werkzeuge.
Ich kann beim Gattungswesen Mensch (toolmaking animal) keine wesentliche Entwicklung erkennen, ich erkenne aber leicht, dass die Gattung ihre Technik und mithin ihre Technologie entwickelt. Die "alten" Griechen waren wohl mindestens so intelligent und beweglich wie ich, aber sie hatten keine Computer und deshalb natürlich auch kein Wissen über Computer. Ich - und andere Menschen, die nicht im unberührten Urwald oder in sogenannten Entwicklungsländern leben - scheinen allenfalls entwickelter, weil wir eine entwickeltere Technik (zur Verfügung) haben. Insofern die Werkzeugherstellung ein Gattungskriterium ist, hatten (tauto)logischerweise bereits die ersten Menschen Werkzeuge, wenn auch sehr primitive. Die menschliche Gattung enwickelt nur ihre Technik, Tiere entwickeln sich - von Genmutationen abgesehen - gar nicht.
Aristoteles lebte in einer Epoche der antiken Polis, in welcher die Werkzeuge noch von Sklaven benutzt wurden. Aristoteles entwickelt deshalb sein Geschlecht nicht im Umgang mit Werkzeugen, sondern politisch im Umgang mit Sklaven. Deshalb schien ihm der Menschen ein politisches Tier. B. Franklin, dagegen war als einer der Begründer der USA ein Yankee, der Werkzeuge und Maschinen anstelle der Sklavenhaltung setzen wollte, deshalb sah er das toolmaking animal. Und unabhängig von den beiden, neigt die Geschichtsschreibung dazu, ihre Epochen anhand der Entwicklung der Technologie einzuteilen. In diesem - etwas tierischen - Sinne würde ich allenfalls sagen, der Mensch unserer Epoche ist ein systemerzeugendes Tier.
Ausblick
Ich werde später etwas zur Kybernet-ik schreiben und diese als Teil der Technik von der Kyberno-logie unterscheiden.